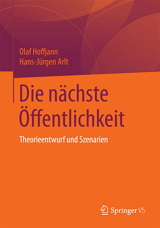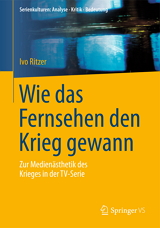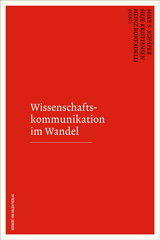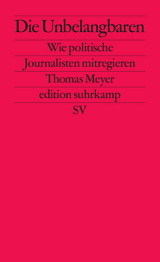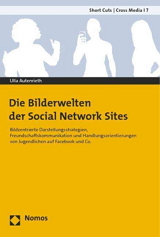Ein Essay von Siegfried Weischenberg
Anmerkungen zum Zustand der Medien- und Journalismuskritik – aus Anlass der Generalabrechnung eines Politikwissenschaftlers
Die Kritik am Journalismus und seinen Protagonisten ist so alt wie der (moderne) Journalismus selbst. Da gab es schon vor mehr als 150 Jahren – in Gustav Freytags Lustspiel
Die Journalisten (1853) – den Schmock als Prototyp des Schmierlappen, gefolgt von (mehr oder weniger) kulturkritischen Analysen zu den aufkommenden Massenmedien durch besorgte frühe Zeitungskundler; Max Weber gehörte einige Zeit später zu den Wenigen, die Pauschalurteile über die Zunft öffentlich als ungerecht bezeichneten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde von Philosophen und anderen, die sich Gedanken machten über die junge Demokratie und ihre Zukunft, gefragt, ob die Bevölkerung richtig informiert werde, so dass sie vernünftige Wahlentscheidungen treffen könne. In den 1970er Jahren geriet dann der öffentlich-rechtliche Rundfunk ins Visier vor allem konservativer Kritiker, die glaubten, dass die Bundestagswahl 1976 durch einseitige Berichterstattung linksliberaler TV-Journalisten zu Ungunsten der CDU/CSU beeinflusst worden sei. Im Jahrzehnt darauf musste man eher befürchten, dass diese Medienakteure so sehr domestiziert worden waren, dass Kritik und Kontrolle der Politik kaum noch stattfand; gleichzeitig wurde das duale Rundfunksystem auf den Weg gebracht, wovon sich insbesondere konservative Politiker und katholische Geistliche mehr 'Ausgewogenheit’ versprachen. Die SPD hatte sich diesen 'neuen Medien’ zumindest nicht verweigert.
Mehr