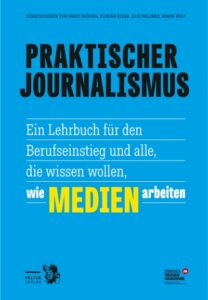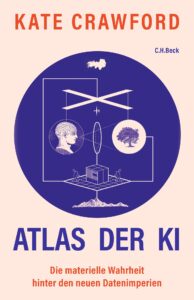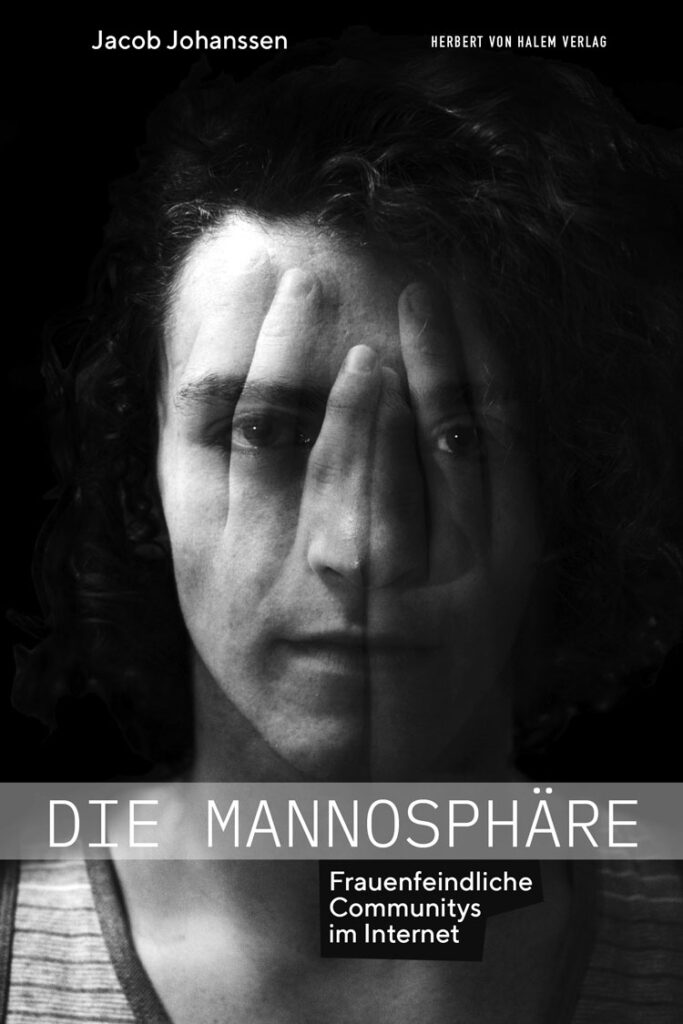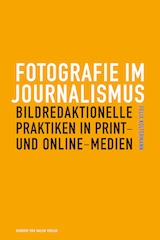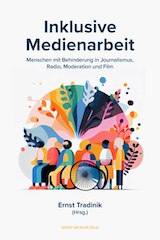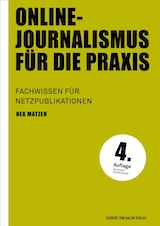Rezensiert von Beatrice Dernbach
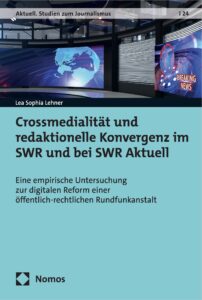

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht seit Jahrzehnten unter Beschuss. Waren und sind es in erster Linie die Zeitungsverleger, die nach wie vor die Finanzierung aus Gebührengeldern auf dem Kieker haben, kommen heute grundlegende politische, Struktur- und Vertrauensfragen hinzu. Zwar bedeuten die ökonomischen, politischen und sozialen Herausforderungen keine substanzielle Bedrohung des Systems, aber aufgrund des Legitimationsdrucks müssen sich die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu öffentlich-rechtlichen Medienhäusern entwickeln. Im Kern stehen dabei Social-Media-Strategien, um vor allem jüngere Menschen zu gewinnen und zu binden. Das beschreibt kurz und viel zu knapp die Ausgangslage der umfangreichen Studie Lea Sophie Lehners, die in gekürzter Fassung seit einigen Monaten als Buch vorliegt. Mehr