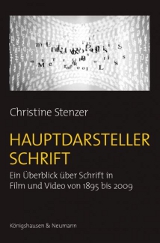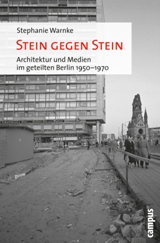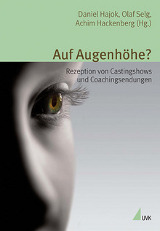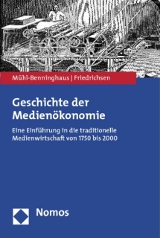Wiedergelesen von Achim Eschbach
Karl Bühler (1879-1963) stammte aus Meckesheim bei Heidelberg. Nach dem Abitur studierte er in Freiburg Medizin und im Anschluss daran Philosophie in Straßburg. Als Assistent von
Oswald Külpe arbeitete er im Kreise seiner Würzburger Kollegen an seiner Habilitationsschrift, die unter dem Titel
Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie der Denkvorgänge (Bühler 1907/08) publiziert worden ist. Bühler folgte Külpe an die Universitäten Bonn und München, wo sie experimentalpsychologische Laboratorien aufbauten. 1918 erhielt Karl Bühler an der TU Dresden seinen ersten eigenen Lehrstuhl und 1922 folgte er dem Ruf an die Universität Wien, wo er im Laufe der folgenden sechzehn Jahre gemeinsam mit seiner Frau Charlotte Bühler und zahlreichen äußerst begabten Mitarbeitern und Schülern, zu denen u. a. Egon Brunswik, Paul Lazarsfeld, Bruno Bettelheim, Marie Jahoda, Rudolf Ekstein, Karl Popper, Konrad Lorenz, Hildegard Hetzer usw. zählten, die Wiener Psychologische Schule aufbaute. 1938 wurde Karl Bühler von der Gestapo verhaftet und kurze Zeit später aus seinem Amt entlassen. Gemeinsam mit seiner Tochter Ingeborg verließ er Wien und verbrachte die folgenden fünfundzwanzig Jahre im amerikanischen Exil. Der außerordentliche Erfolg, den Karl Bühler bis zum Beginn der Naziherrschaft mit seinen zahlreichen Publikationen in den deutschsprachigen Ländern erzielt hatte, flaute jäh ab, wofür nicht nur die Tatsache verantwortlich zu machen ist, dass beispielsweise in Amerika deutschsprachige Literatur nicht zur Kenntnis genommen wird. Es ist allerdings auch nicht zu bestreiten, dass sich Karl Bühler seit seiner Habilitation mehrfach in Opposition zu den herrschenden Paradigmen befand. Und wenn man dem Denkstil eines Denkkollektivs widerspricht, so ist das selten karriereförderlich.
Mehr