Rezensiert von Kristina Wied
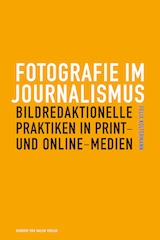

Kein Text ohne Bild – dieser Devise folgt der Print- und Onlinejournalismus. Doch obgleich das Visuelle eine hohe Relevanz in der journalistischen Berichterstattung hat, erscheint dessen Stellenwert der tatsächlichen redaktionellen Praxis nicht zu entsprechen. Felix Koltermann wirft mit seinem Buch ein Schlaglicht auf den Umgang mit Fotografie in deutschen Print- und Onlineredaktionen. Er versucht, “einen allgemein verständlichen Zugang zu Fragen der journalistischen Bildkommunikation” (16) zu bieten. Dies gelingt ihm nicht immer gleich gut.
Koltermann – Kommunikationswissenschaftler, Journalist und Fotograf – präsentiert die Ergebnisse eines Forschungsprojekts, das er im Studiengang “Visual Journalism and Documentary Photography” der Hochschule Hannover leitete. Forschungspraktischer Kern waren Interviews und “Ortsbesuche” (16) sowie Blatt- und Bildkritiken, um eine Bestandsaufnahme von bildredaktionellen Praktiken vorzunehmen und über das Verhältnis von Fotografie und Journalismus zu reflektieren.
Mit seiner Studie adressiert Koltermann eine Leerstelle in der bisherigen Forschung. Er verwendet dazu einen qualitativen, journalistisch geprägten Mehodenmix der empirischen Sozialforschung. Die Ergebnisse sind zwar interessant, bleiben jedoch zwangsläufig Momentaufnahme eines extrem dynamischen Marktes, der durch Digitalisierung und den zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz geprägt ist.
Im ersten Teil des Buches stellt Koltermann zunächst aufschlussreiche Daten zu Foto- und Bildredakteur:innen deutscher Zeitungen vor (vgl. 19-26). Es folgen die Ergebnisse einer Inhaltsanalyse, in der Bilder von 24 Ausgaben sechs deutscher (über)regionaler Tageszeitungen aus dem Jahr 2019 (vgl. 27-33) untersucht wurden, u. a. zum Einsatz verschiedener Bildgattungen sowie deren Quellen und Bildcredits.
Transkripte von Gesprächen mit 15 Personen, die auf die eine oder andere Art und Weise am Prozess journalistischer Bildproduktion beteiligt sind bzw. waren (vgl. 34-114), bilden den vierten Abschnitt. Zu den Gesprächspartnerinnen und -partnern zählen Sabine Pallaske von der Mittelstandsgemeinschaft Fotomarketing, Monika Plhal von der Bildnachrichtenagentur European Press Photo Agency, Marcus Hormes, 2020 Leiter einer Lokalredaktion beim Trierischen Volksfreund, sowie Thomas Geiger, ehemals Vorsitzender der Fachgruppe Bildjournalismus des Bayerischen Journalistenverbands. Die Leser:innen erhalten dadurch zwar die Möglichkeit, sich selbst ein Bild von den Einstellungen und Erfahrungen dieser Fachleute zu machen und eigene Schlüsse zu ziehen. Allerdings werden sie dabei weitgehend alleine gelassen.
Danach beschreibt Koltermann seine “Ortsbesuche”, in denen er Kurzreportagen zu neun Redaktionen (z.B. der Bildredaktion der Neuen Zürcher Zeitung), Akademien (wie dem Workshop “Grundlagen der Bildredaktion” der Emerge Akademie) und Veranstaltungen (bspw. dem European Publishing Congress) dokumentiert (vgl. 115-153). Seine Darstellungen bieten knappe Einblicke in die Arbeits- und Ausbildungspraktiken von Bildredakteur:innen jeweils zum Zeitpunkt der Beobachtung zwischen Februar 2020 und Mai 2022.
In 13 Bildkritiken greift Koltermann aktuelle Fragen der journalistischen Bildkommunikation anhand einzelner Artikel auf (vgl. 154-190). Diese sind gründlich recherchiert, gut belegt und nachvollziehbar analysiert. So veranschaulicht er normative Fehltritte und Versäumnisse in der Bildkommunikation und weist auf missverständliche oder gar falsche Kontextualisierung durch die Bildauswahl oder die Bild-Text-Beziehung hin. Hier schafft er eine klare Orientierung für seine Leserschaft.
Schließlich vergleicht Koltermann Titelseiten ausgewählter Printmedien zu sechs Ereignissen mit nationaler oder internationaler Tragweite, darunter der Beginn des Ukraine-Krieges 2022, das Ergebnis der Bundestagswahl 2021 und die Terroranschläge von 9/11 (vgl. 191-216). Die Analysen lassen sich gut nachvollziehen; die Ergebnisse sind aufschlussreich. Auch wenn die analysierten Titel über dasselbe Ereignis berichteten, sind die Deutungen unterschiedlich – entscheidend ist dabei meist die Kontextualisierung.
Im Anhang (vgl. 217-279) liefert Koltermann eine ansehnliche Sammlung an Literaturempfehlungen, systematisch nach Publikationsarten gegliedert, und ein umfangreiches Linkverzeichnis. Dieses reicht von Links zu Dienstleistern auf dem Bildmarkt, Verlinkungen zur Software für Redaktionen über Websites, die der Bildverifikation dienen, bis hin zu einer Auflistung von Internetadressen von Verbänden und Institutionen, die sich um Fotojournalismus verdient machen.
In akribischer Kleinarbeit hat er zudem einen nützlichen Anhang zu rechtlichen Regelungen und ethischen Normen zusammengestellt, etwa zur Namensnennung, zur Kennzeichnungspflicht manipulierter Fotos oder zum Umgang mit digitalen Meta-Daten. Ein Glossar, das von Adobe Bridge bis zur Zweitnutzung reicht, rundet diese Fleißarbeit ab.
Insgesamt ist das Buch vielschichtig und detailreich. Koltermann präsentiert zahlreiche Mosaiksteine zu bildredaktionellen Praktiken im gedruckten und digitalen Journalismus in Deutschland. Diese stehen jedoch größtenteils unverbunden nebeneinander, ohne zu einem kohärenten Gesamtbild zusammengefügt zu werden.
Zum Schluss stellt sich eine provokante Frage: Warum wurde dieses Buch eigentlich veröffentlicht? Koltermann selbst weist darauf hin (vgl. 16), dass es sich – bis auf vier Ausnahmen – um eine Auswahl von Texten handelt, die bereits zwischen 2019 und 2022 geballt auf der Website www.bildredaktionsforschung.de publiziert wurden und dort nach wie vor frei zugänglich sind.
Vor diesem Hintergrund kann das Buch als gedruckte Dokumentation des abgeschlossenen Forschungsprojekts angesehen werden, ergänzt um hilfreiche Hinweise zum Nachschlagen und zur vertieften Auseinandersetzung, die jedoch ebenfalls über die genannte Website zugänglich sind.
Links:
Über das BuchFelix Koltermann: Fotografie im Journalismus. Bildredaktionelle Praktiken in Print- und Online-Medien. Köln [Herbert von Halem] 2023, 284 Seiten, 28,- EuroEmpfohlene ZitierweiseFelix Koltermann: Fotografie im Journalismus. von Wied, Kristina in rezensionen:kommunikation:medien, 4. April 2025, abrufbar unter https://www.rkm-journal.de/archives/25405
