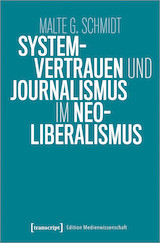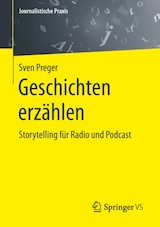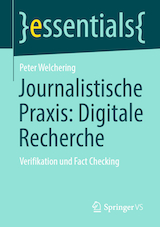Rezensiert von Ralf Spiller


Der Begriff des Friedensjournalismus taucht bereits um 1900 zum ersten Mal auf, die sozialwissenschaftliche Forschung beschäftigt sich seit etwa 25 Jahren mit dem Konzept. Doch was genau ist Friedensjournalismus? Ein Journalismus über den Frieden? Ein normatives Konzept, wie Berichterstattung erfolgen sollte? Oder vielleicht noch etwas anderes? Kempfs kurzes Buch bringt Licht ins Dunkel. Der Band beginnt mit einem Kapitel von Sonja Kretzschmar und Annika Sehl, in dem die beiden Autorinnen verschiedene Ansätze des Friedensjournalismus aufzeigen und in die bisherige Journalismusforschung einordnen. Mehr