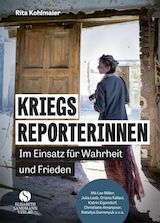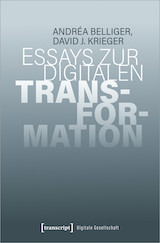Rezensiert von Hans-Dieter Kübler


Vor etwa 60 Jahren veröffentlichte Jürgen Habermas seine inzwischen breit angesehene und diskutierte Habilitationsschrift Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Öffentlichkeit (1962). Als ein “Idealtypus”, mindestens als ein “Modell” war die Untersuchung angelegt. Habermas untersuchte mit juristisch-staatspolitischen und sozialwissenschaftlichen Begriffen zunächst die Entstehung der “bürgerlichen Öffentlichkeit” im 17./18. Jahrhundert aus Assoziationen literarischer, kultureller Zirkel, von Vereinen, politischen Gruppierungen, Stammtischen, Clubs und Salons, aber auch von Logen und Geheimbünden. Diese formierten sich zum “Publikum versammelter Privatleute”, gewissermaßen als informelle, diskursive Vermittlungsinstanzen zwischen Staat und (Zivil)Gesellschaft. Mehr