Rezensiert von Saskia Handro
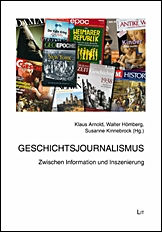

Die erste Gruppe von Beiträgen lotet die inhaltlich-formale Dimension des Verhältnisses von Geschichte und Journalismus aus. Während Walter Hömberg Geschichtsjournalismus phänomenologisch beschreibt, wendet sich Horst Pöttker Formen journalistischer Re-Aktualisierung zu und entfaltet die Konstruktion lebensweltlicher Anschlussfähigkeit als konstitutives Merkmal geschichtsjournalistischen Erzählens, das die Qualität medialer Rezeptionsprozesse beeinflusst. Den Blick für Medien als eigenständige Konstrukteure von Geschichte, denen nicht nur eine mediale Transferfunktion zukommt, sondern die gerade im Feld der Zeitgeschichte auch Impulse für historische Forschung setzten, schärft der Beitrag von Frank Bösch. Aus der Akteursperspektive entfaltet Jochen Kölsch die Interdependenz von Inhalt und Darstellungsform. Die Diskussion der Möglichkeiten und Grenzen televisueller Geschichtserzählungen zwischen Dokumentation und Fiktion verdeutlicht, dass für eine adäquate Beurteilung filmischer Inszenierungen systemfremde, d. h. wissenschaftlich normative Kriterien kaum taugen.
![]()

Den Akteuren geschichtsjournalistischer Kommunikationsprozesse widmet sich eine zweite Gruppe von Beiträgen. Klaus Arnold begibt sich auf die Suche nach dem Typus des Geschichtsjournalisten und seine quantitative Befragung von Redakteuren offenbart den Widerspruch zwischen medialem Geschichtsboom und geringem Professionalisierungs- und Institutionalisierungsgrad. Nicht allein die Binnenperspektive journalistischer Arbeit, sondern mediale Kommunikation als Interaktion von Produzenten und Rezipienten, als wechselseitige Vergewisserung von Identität und historischer Orientierung, entfaltet die Münchener Forschergruppe Pfaff-Rüdiger/Riesenberger und Meyen entlang qualitativer Befunde. Während die Grenzen zwischen wissenschaftlichem und journalistischem Erzählen den impliziten Vergleichshorizont vieler Beiträge bilden, verfolgt Jürgen Wilke die Konstruktion dieser Grenzen in historischer Perspektive und charakterisiert an biografischen Fallbeispielen zweier Grenzgänger das Spannungsverhältnis zwischen Produzenten und Publika.
Das theoretische Konzept der Erinnerungskultur verbindet die dritte Gruppe von Beiträgen. Hier gewinnen die Modi geschichtsjournalistischer Selektion an Kontur. Während Ilona Ammann mit dem Gedenktagsjournalismus systemspezifische Rekonstruktionsleistungen im Feld der Erinnerungskultur theoretisch entfaltet, charakterisiert Martin Krieg am Beispiel der wandelnden Berichterstattung über den 20. Juli 1944 Gedenktagsjournalismus als “Collective-Memory-Setting” und betont unter Vernachlässigung geschichtskultureller Diskursstrukturen den Aspekt medialer Selbstreferentialität. Auch wenn Inhaltsanalysen weniger Aufschlüsse über gesellschaftliche Diskursstrukturen versprechen, bieten sie dennoch Einblicke in Prozesse medialer Kanonisierung von Ereignissen und Bildern, wie der Beitrag von Andre Donk und Martin Herbers zur Darstellung des 11. September in deutschen und amerikanischen Tageszeitungen zeigt. Doch auch in kulturvergleichender Perspektive drängt sich die Frage nach der Sinnstiftungsfunktion der Selektion, nach den zeitgebundenen Identifikations- und Orientierungsbedürfnissen auf.
![]() Susanne Kinnebrock: An wen richtet sich der Band?
Susanne Kinnebrock: An wen richtet sich der Band?
Geschichtsjournalistische Popularisierungsstrategien im Fernsehformat untersucht die vierte Gruppe von Beiträgen. Stefanie Samida rekonstruiert Authentizität, Dramatisierung und Emotionalisierungseffekte am Beispiel archäologischer Dokumentationen. Dramaturgische Strategien historischer Re-enactments als Nivellierung von kultureller und zeitlicher Alterität und damit als Brücke historischen Verstehens und Identifikationsangebot für Zuschauer analysieren Manuel Glaser, Bärbel Garsoffsky und Stephan Schwan. Die Interaktion geschichtskultureller Felder interessiert Alexander Schubert, der kulturhistorische Großausstellungen als Form populärer Geschichtsvermittlung begreift, aber leider nur in Ansätzen Strategien geschichtsjournalistischer Vermarktung aufzeigt.
Dass die Historisierung des Geschichtsjournalismus vor scheinbaren Neuentdeckungen ebenso schützt wie vor der Wiederholung stereotyper Vorurteile gegenüber historischen Dokumentationen zeigen die letzten Beiträge, die die Etablierung und Entwicklung historischen Erzählens im Fernsehformat als Experimentieren mit Darstellungsformen, als Reflexion von Publikumserwartungen und Fernsehkritik, als Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und Grenzen filmischer Rekonstruktion entlang ästhetischer Konventionen vergegenwärtigen. Ob im Blick auf die Anfänge der Geschichtsdokumentation (Edgar Lersch) oder auf die Geschichte des Dokumentarspiels (Christian Hißnauer) – aus wissenschaftlicher Perspektive gezogene Grenzen zwischen Fiktionalität und Faktizität, zwischen Dokumentation und Spielfilm erscheinen als Gradmesser für die Qualität filmischen Erzählens, das medieneigenen Konventionen, Traditionen und Funktionen folgt, ungeeignet. Folglich stellt die Beschäftigung mit dem Geschichtsjournalismus eine interdisziplinäre Herausforderung dar, die nicht nur angesichts des medialen Geschichtsbooms, sondern auch mit Blick auf neue, in diesem Band weniger berücksichtigte Trends der Medialisierung von Geschichte – wie Visualisierung, Segmentierung der Angebotsstrukturen und damit auch Publika, Interaktivität in den neuen Medien – als produktives Forschungsfeld erscheint.
Links:
- Verlagsinformationen zum Buch
- Webpräsenz von Klaus Arnold an der Universität Eichstätt
- Webpräsenz von Walter Hömberg an der Universität Eichstätt
- Webpräsenz von Susanne Kinnebrock an der RWTH Aachen
- Webpräsenz von Saskia Handro an der Universität Münster

