Rezensiert von Nadine Bilke
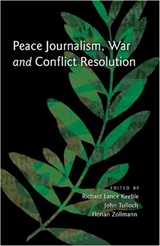

Die scharfe Kritik an der Berichterstattung über Afghanistan und Irak (Edwards, Ruß-Mohl, leider wenig fundiert: Winter) führt zu einer großen Skepsis, ob Massenmedien in der Lage sind, ein Konzept wie Friedensjournalismus umzusetzen. Lynch fordert dennoch, dass der Wandel von innen, aus den Medien heraus kommen müsse (81). Keeble hingegen plädiert dafür, alternative Medien viel stärker zu beachten. Dementsprechend ist ein Aufsatz in dem Band auch der britischen Peace News gewidmet, der Zeitung der britischen Friedensbewegung. Aber auch wenn eine möglichst große Spannbreite von Stimmen für eine pluralistische Öffentlichkeit, die über Krieg und Frieden diskutiert, unabdingbar ist, so schießt Keeble etwas übers Ziel hinaus, als er anregt, die Zeitung der Kommunistischen Partei Großbritanniens könne durchaus Friedensjournalismus sein (57).
Damit denkt er auf radikale Weise die Definition von Pilger in seinem Vorwort weiter: “War journalism reports what power says it does, peace journalism reports what it does.” (xi) Und doch kann das Gegengift zur Allianz der Medien mit der Macht kaum die Allianz mit der Gegenmacht sein, wenn Journalismus seine Glaubwürdigkeit behalten will.
Das Konzept Friedensjournalismus wird in diesem Band auch in eine ganz andere Richtung gedehnt, wenn Maltby Radiosender der NATO und der kanadischen Armee vorstellt. Das Konzept orientiert sich laut der Veranstalter an Lösungen – allerdings an den Lösungen, die die Radio-Macher selbst mit ihrer bewaffneten Präsenz durchsetzen wollen. Weder unabhängig noch objektiv, damit kein Friedensjournalismus: so lautet denn auch Maltbys wenig überraschendes Urteil.
Aber was kann Objektivität überhaupt bedeuten? Diese Frage treibt Aslam um; sie fordert auch vor dem Hintergrund des indisch-pakistanischen Konflikts eine neue Balance im Journalismus: zwischen unmöglicher Objektivität und faktischem “Involvement”. Ins Zentrum rückt damit die journalistische Selbstreflektion, die Rughani in seinem Beiträge über die Visualisierung des Grauens par exellence vorführt: Wie bewahre ich meine Menschlichkeit als Berichterstatter, der im Angesicht menschlichen Leids über Kamerawinkel und Belichtung nachdenkt, um die Story möglichst gut zu verkaufen?
Die Rolle des Krisenberichterstatters wird auch von anderer Seite herausgefordert: Betroffene selbst dokumentieren ihre Erfahrungen in sozialen Netzwerken. In vier lesenswerten Fallstudien zeigen Matheson und Allan, dass es “Grund für Optimismus” (188) und die Hoffnung auf eine vielfältigere globale Öffentlichkeit gibt, ohne die Probleme – hohe Beschleunigung, zweifelhafte Glaubwürdigkeit, starke Polarisierung – zu verschweigen.
Die zahlreichen Fallstudien, praktischen Beispiele und Zitate sind die Stärke des Bandes. In der Analyse von Kriegsberichterstattung fehlen allzu oft die positiven Beispiele, die diese Sammlung ebenfalls liefert. Zollmann analysiert einen alternativen Ansatz der Irak-Berichterstattung. Ein US-Journalist berichtet als Unabhängiger aus der Mitte der irakischen Gesellschaft und schafft damit auch den Sprung in die großen Blätter. Prinzing schreibt über das deutsche Projekt Peace counts, das Friedensmacher porträtiert und damit ein Genre des Friedensjournalismus hoffähig macht.
Und – vielleicht am beeindruckendsten – Patindol schreibt aus eigener Erfahrung über ein philippinisches Netzwerk, das konfliktsensitiven Journalismus (diesen Begriff zieht sie aus praktischer Erfahrung vor) in die Massenmedien getragen hat. Dieses Netzwerk hat sich, um Glaubwürdigkeit aufzubauen, von Nichtregierungsorganisationen distanziert. Wie unabhängig sollte Journalismus sein? Die Frage ist auch in Friedenszeiten relevant, aber in Kriegszeiten stellt sie sich mit noch größerer Dringlichkeit. So unabhängig wie nur möglich – muss wohl die Antwort lauten.
Links:
Über das BuchRichard Lance Keeble; John Tulloch; Florian Zollmann (Hrsg.): Peace Journalism, War and Conflict Resolution. New York u.a. [Peter Lang] 2010, 373 Seiten, 24,80 Euro.Empfohlene ZitierweiseRichard Lance Keeble; John Tulloch; Florian Zollmann (Hrsg.): Peace Journalism, War and Conflict Resolution. in rezensionen:kommunikation:medien, 23. August 2011, abrufbar unter https://www.rkm-journal.de/archives/6021
