Rezensiert von Martin Welker
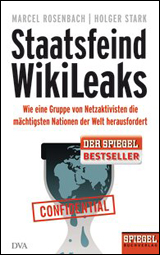

Für Medien- und Kommunikationswissenschaftler, insbesondere für Journalistik-Versierte, mag das Buch von Rosenbach und Stark somit das Interessantere sein. Es enthält zahlreiche aufschlussreiche Passagen zur journalistischen Valenz von Wikeleaks und zur Frage der Veränderung von klassischem Journalismus durch die neuartige Enthüllungsplattform. Macht Wikileaks Journalismus? Ist die Plattform überhaupt ein Medium? Wie können neue Technologien eingesetzt werden, um staatliche Überwachung und Kontrollwahn einzugrenzen? Wie verändert sich das Verhältnis von Öffentlichkeit und Nicht-Öffentlichkeit? Diese sind die Kernfragen, die bei Rosenbach und Stark explizit und intensiv diskutiert werden. Die Person Assange wird dabei nur als spannender Einstieg genutzt, als Reizfigur, welche die Vorgeschichte besser verstehbar macht. Die profunderen Abschnitte des Buches finden sich dann überwiegend im letzten Viertel des Textes.
Die erste Frage, ob Wikileaks Journalismus mache, wird dabei mit “nein” beantwortet: “Der entscheidende Unterschied, der Wikileaks von klassischem Journalismus abhebt, ist der Anspruch, jede Art von Dokumenten zu veröffentlichen, die eingesendet wird. Guter Journalismus versucht, einen gesellschaftlich relevanten Vorgang zu beschreiben, Missständen auf den Grund zu gehen. (…) Wikileaks hat dagegen das Versprechen gegeben, alles zu veröffentlichen, was den Weg zu ihnen findet, wenn es nur einen Test auf Authentizität besteht” (Rosenbach/Stark 2011: 295). Eine Relevanzbewertung, wie sie der Journalismus tagtäglich vornimmt, ist nicht zu erkennen. Und mehr noch: Wikileaks ist noch nicht einmal als klassisches Medium, sondern eher als ein Zwitter aus Medium und Internetplattform zu werten (dies.: 304). “In autoritären Regimen könnten solche Plattformen die Rolle übernehmen, die eine freie Presse in Demokratien spielt”. Davon sei Wikileaks allerdings noch weit entfernt, sind sich Rosenbach und Stark sicher. Vielmehr sei die Plattform ein “öffentliches Archiv des vormals Nicht-Öffentlichen” (dies.: 205). Damit leiste Wikileaks aber einen Dienst an der Demokratie, so die Argumentation der Autoren. Denn “die Regierungen von heute sind konspirativer als ehedem, sie produzieren mehr Staatsgeheimnisse und betreiben einen immensen Aufwand, sie zu schützen” (dies.: 310).
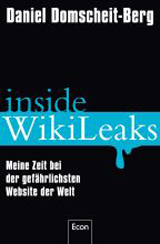

Wikileaks als Organisation folgte bisher eher einer Hackerethik, nicht journalistischen Maximen. Assange ist auch kein Journalist, sondern vielmehr der Organisator eines medien- und journalismuskritischen Projekts (vgl. Rosenbach/Stark 2011: 301/302). Deshalb braucht Wikileaks Journalismus. Ohne auf die solide Arbeit von Spiegel, Guardian oder New York Times zurückzugreifen, hätte Wikileaks die letzten großen Enthüllungen nicht leisten können und insbesondere nicht diese öffentliche Wirkung erzielt. Das Buch von Rosenbach und Stark zeigt aber, wie sich die Arbeit in modernen Redaktionen verändert und welche große Rolle dem Fact-Checking zufällt.
Wissenschaftliche Theorien oder auch nur forschungsmäßige Thesen sollte der kommunikationswissenschaftlich instruierte Leser in beiden Büchern nicht erwarten. Die Bände sind keine wissenschaftlichen Werke, sondern politische Bücher, das Spiegel-Buch ausgeprägter, das Ullstein-Buch weniger stark, da es durchgängig subjektiv angelegt ist. Auch stilistisch ist der Text von Domscheit-Berg stellenweises holprig. Der Leser merkt dem Text an, dass er aus gesprochener Sprache gefertigt wurde. Geschliffener und zugleich spannend liest sich das Buch von Rosenbach und Stark, das allerdings in Auszügen schon im Nachrichtenmagazin Spiegel zu lesen war.
Wer sich für Fragen wie “Öffentlichkeit und Privatheit”, “Neue Tendenzen im Journalismus” oder “Staatliche Überwachung versus Datenschutz” interessiert, findet in beiden Büchern aktuelle Einsichten. Im Falle des Spiegel-Buchs werden diese auf einem abstrakteren Niveau diskutiert, im Falle von Domscheit-Berg aus eigener Erfahrung und persönlichen Erlebnissen, die stellenweise auch technikzentriert ausfallen. Beide Bücher sind politische Begleitliteratur, können Wissenschaftler aber durchaus zu neuer Forschung anregen.
Links:
- Verlagsinformationen zum Buch “Staatsfeind Wikileaks”
- Verlagsinformationen zum Buch “Inside Wikileaks”
- Private Homepage von Martin Welker
Daniel Domscheit-Berg: Inside WikiLeaks. Meine Zeit bei der gefährlichsten Website der Welt. Berlin [Ullstein Buchverlage] 2011, 304 Seiten, 18,- Euro.Empfohlene ZitierweiseProjekt Wikileaks. von Welker, Martin in rezensionen:kommunikation:medien, 23. Juli 2011, abrufbar unter https://www.rkm-journal.de/archives/5804


Wikileaks ist einfach unheimlich interessant, aber ich denke nicht, dass es direkten Einfluss auf die Politik hat.