Rezensiert von Gabriele Hooffacker
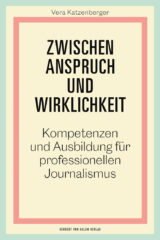

Womit sehen sich angehende Journalistinnen und Journalisten konfrontiert? Hat die akademische Journalismus-Ausbildung sie angemessen auf die berufliche Realität vorbereitet? “Zwar hat die Digitalisierung die journalistische Ausbildung, Karrieren und Abläufe in regionalen Medienunternehmen verändert. Doch es bestehen Defizite”, konstatiert Oliver Haustein-Teßmer (Haustein-Teßmer 2024: 68).
Was liegt näher, als Berufsanfängerinnen und -anfänger im Journalismus nach ihren Erfahrungen zu befragen? Und ergeben sich womöglich Perspektiven auf die beunruhigende Beobachtung, dass immer weniger Hochschulabsolventinnen und -absolventen einen journalistischen Beruf anstreben?
In ihrer Dissertation von 2022, die nun als Buch im Herbert von Halem Verlag vorliegt, geht Vera Katzenberger in zwei Teilstudien – einer qualitativen und einer quantitativen Befragung – dieser Problematik nach. Als integrativen Orientierungsrahmen hat sie die Feldtheorie nach Pierre Bourdieu mit ihren zentralen Elementen von Feld, Habitus und Kapital herangezogen. Spannend zu lesen sind die empirischen Befunde.
In Teilstudie I wurden 25 Personen interviewt, davon 16 Frauen und 9 Männer im Alter zwischen 21 und 32 Jahren (161ff.). Dabei lag deren Berufserfahrung zwischen einem und sechs Jahren. Fast alle hatten einen Hochschulabschluss an einer HAW oder einer Universität, meist in einem Journalismus- oder Medienwissenschafts-Studiengang. Nur eine der befragten Personen war mit einem abgebrochenen Studium über eine Journalistenschule in den Beruf gelangt. Alle hatten vor dem Berufseinstieg mehrere Praktika absolviert (vgl. 164).
Das Fazit der Befragten war ernüchternd: “Insgesamt schien es, als würde die ursprüngliche Vorstellung vom Journalismus als kreativem, abwechslungsreichem, gesellschaftlich relevantem Traumjob […] recht bald nach dem Berufseintritt erschüttert. Es entstand der Eindruck, als würden sie schon früh in ihrer Karriere von der beruflichen Wirklichkeit eingeholt” (171). Beunruhigt waren die Befragten vom abnehmenden Vertrauen in den Journalismus sowie der geringen Einschätzung der Glaubwürdigkeit des Journalismus (vgl. 182). Hinzu kamen Anfeindungen auf Social Media oder im öffentlichen Raum (vgl. 184).
Fühlen sich die jungen Journalistinnen und Journalisten auf die Digitalisierung des Berufs vorbereitet? In ihren Antworten legten sie weniger Wert auf Training in speziellen digitalen Tools, sondern auf technologische Offenheit. Man müsse allgemein “sehr offen und flexibel gegenüber neuer Technik sein”, so eine der Befragten (186). Dabei sei ein kompetenter Umgang mit den verschiedenen Plattformen wichtig (vgl. 189). Verlangt werde außerdem, für alle Medien und Plattformen produzieren zu können, von Print über Podcast bis hin zu Instagram-Reels.
Was davon haben die angehenden Journalistinnen und Journalisten in ihrer Hochschulausbildung gelernt? Zusammenfassend beurteilten sie Hintergrundwissen zum Mediensystem und zur Mediengeschichte als hilfreich, betonten aber, vor allem ethische Richtlinien mitgenommen zu haben (vgl. 196). Bei der Beurteilung des Praxisbezugs schnitten insbesondere Studiengänge an HAWs gut ab (vgl. 200).
In Teilstudie II wurden Berufseinsteigerinnen und -einsteiger online befragt. Nach Bereinigung blieb ein Datensatz mit 228 Personen übrig. Hier war die Altersspanne größer als in Teilstudie I. Bis auf 2,7 Prozent hatten die meisten entweder einen Hochschulabschluss (81,7 Prozent) oder zumindest (Fach-)Abitur. Mit ihrer Ausbildung zeigten sich die Befragten mehrheitlich zufrieden, wenn sich auch in einzelnen Bereichen ein divergentes Bild zeigte. 68,5 Prozent gaben an, “dass Journalistinnen und Journalisten bei ihrer Arbeit verstärkt mit Misstrauen und Anfeindungen konfrontiert seien” (250).
Vera Katzenberger fasst die Erkenntnisse beider Teilstudien so zusammen: “Nach dem beruflichen Eintritt ins journalistische Feld waren es aus der Perspektive der befragten jungen Journalistinnen und Journalisten zum Zeitpunkt der Erhebung vor allem technologische Entwicklungen rund um Social Media, Smartphones und Algorithmen, wirtschaftliche Einflüsse und Profiterwartungen in den Redaktionen sowie geringes Ansehen von Journalismus bzw. Anfeindungen gegen Journalistinnen und Journalisten, die das journalistische Feld prägten und seine Autonomie beschränkten oder sogar gefährdeten” (291).
Sie diagnostiziert nicht nur ein Dialogisierungsdefizit, bezogen auf publikumsorientierte Darstellungsformen, sondern auch ein Innovationsdefizit hinsichtlich technologischer Entwicklungen (vgl. 294). Letztendlich bleibt in der Studie die Frage offen, ob die hochschulgebundene Journalismusausbildung eher für den Markt qualifiziert oder für eine kritische Begleitung der Entwicklung in Medien und Gesellschaft. Doch wird deutlich, dass die Arbeitsbedingungen der Befragten – wenig Geld für hohe Arbeitsbelastung und viel Verantwortung – äußerst belastend sind.
Die Studie von Vera Katzenberger kann allen nur wärmstens empfohlen werden, die derzeit in der Journalismus-Ausbildung tätig sind, denn auch hier gibt es Verbesserungsbedarf (vgl. Dernbach 2022). Insbesondere geben die benannten Defizite wichtige Anhaltspunkte für die weitere Entwicklung von Curricula in Hochschulen und Journalismusschulen.
Woran jedoch auch die beste Journalismus-Ausbildung kurzfristig nichts zu ändern vermag, sind der zu beobachtende Vertrauensverlust des Publikums gegenüber den Medien und die damit verbundenen Anfeindungen, denen Journalistinnen und Journalisten (und auch die Hochschullehrerinnen und -lehrer) ausgesetzt sind. Es bleibt nur zu hoffen, dass sich weiterhin engagierter journalistischer Nachwuchs findet, der langfristig für einen lebendigen, kritischen Journalismus eintritt. Dafür bedarf es der entsprechenden Rahmenbedingungen. Auf die Defizite hat Vera Katzenberger deutlich hingewiesen.
Literaturverzeichnis:
Dernbach, Beatrice: Ausbildung für Journalismus. In: Löffelholz, Martin; Rothenberger, Liane: Handbuch Journalismustheorien. Wiesbaden [Springer VS] 2022, S. 475-487.
Haustein-Teßmer, Oliver: Wie die Digitalisierung die Journalismusausbildung verändert. In: Hooffacker, Gabriele; Kenntemich, Wolfgang; Kulisch, Uwe: Neue Plattformen – neue Öffentlichkeiten. Wiesbaden [Springer VS] 2024, S. 67-78.
Links:
Über das BuchVera Katzenberger: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Kompetenzen und Ausbildung für professionellen Journalismus. Köln [Herbert von Halem Verlag] 2024, 393 Seiten, 24 EuroEmpfohlene ZitierweiseVera Katzenberger: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit. von Hooffacker, Gabriele in rezensionen:kommunikation:medien, 10. Dezember 2024, abrufbar unter https://www.rkm-journal.de/archives/25269
