Rezensiert von Friedrich Edelmayer
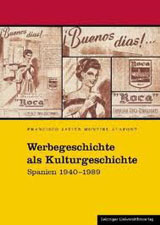

Er teilt den erforschten Zeitraum in vier Abschnitte, die erste Zeit nach dem Bürgerkrieg bis 1949, in der sich Spanien nur mühsam von den Folgen der kriegerischen Auseinandersetzungen erholte und unter der Diktatur, der politischen Repression, der internationalen Isolation und dem Hunger litt; dann die Dekade bis 1959, in der sich die Diktatur intern stabilisierte und wegen des Kalten Krieges vom demokratischen Westen umworben wurde; danach die 15 Jahre bis 1975, in denen sich Spanien langsam hin zu einer modernen, industrialisierten Konsumgesellschaft entwickelte, während gleichzeitig die niedergehende Diktatur die Entstehung einer Zivilgesellschaft nicht verhindern konnte; und schließlich die ersten 15 Jahre des demokratischen Spanien, in denen der Staat 1986 auch in die Europäische Union aufgenommen wurde.
Obwohl dieser Abschnitt in der Kapitelnummerierung etwas unübersichtlich ist – Kapitelangaben im Stil von 4.2.2.1.4 sind keine Seltenheit – verbergen sich hier doch die Ergebnisse extremer wissenschaftlicher Knochenarbeit, die sehr lesenswert sind. Immer wieder geht der Autor auf die jeweiligen Hauptthemen der Werbung ein und versucht meistens sehr gekonnt, diese mit der (Kultur-)Geschichte zu kontextualisieren. Das Buch ist mit mehr als 180 Abbildungen von Werbeplakaten und -inseraten auch sehr gut illustriert. Trotzdem kann man es mit Gewinn nur dann lesen, wenn man auch gut Spanisch versteht. Denn der Autor verwendet in seinem Text zu viele Direktzitate in dieser Sprache, die seine Argumente erhärten oder konkretisieren und illustrieren sollen, doch viele Leser werden dem nicht folgen können.
Auch die Graphiken selbst sprechen nur die Leserinnen und Leser mit Sprachkenntnissen an. Der Witz und Zynismus, die Kritiken und Anspielungen, die dort vorkommen, werden im Text nicht so ausführlich erläutert, dass alle Interessierten das vollständig verstehen können. Das ist insofern schade, als der Autor damit auf jene Anerkennung verzichten muss, die ihm aufgrund all seiner Anstrengungen eigentlich zustehen würde. Klarerweise wollte er sein Thema einer deutschsprachigen Leserschaft näherbringen, doch wäre es besser gewesen, das Buch gleich in spanischer Sprache zu verfassen. Dann gäbe es wenigstens einen klaren Konsumentenkreis.
Was Montiel Alafont in seinem Buch auch zeigen will, nämlich wie einzelne Firmen durch Werbung ihre Produkte vermarkten und an den Mann/die Frau bringen wollten, das gelingt ihm mit seinem eigenen Produkt leider zu wenig. Eine hervorragende Arbeit wird unverdientermaßen in ganz wenigen Bücherregalen vor sich hindämmern. ¡Qué lástima! – und das übersetze ich jetzt absichtlich nicht.
Links:
- Verlagsinformationen zum Buch
- Webpräsenz von Francisco Javier Montiel Alafont an der HAW Hamburg
- Webpräsenz von Friedrich Edelmayer am Institut für Geschichte der Universität Wien

