Eine Literaturrecherche von Hans-Dieter Kübler
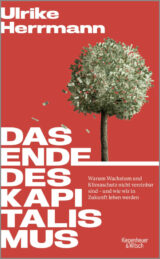

1. Einleitung: gegenwärtige und künftige Herausforderungen
Breitere und beschleunigte Digitalisierung sämtlicher potenziell möglicher Prozesse und Institutionen/Organisationen, demografischer Wandel, vor allem einerseits mit der gravierenden Folge des Fachkräftemangels – hierzulande werden bis 2035 rund 7 Millionen Fachkräfte fehlen – und andererseits mit der ansteigenden Überalterung, den anwachsenden Versorgungsproblemen sowie der Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft möglichst zu emissionsfreien, umweltverträglichen Produktions- und Reproduktionsmodalitäten – das sind die wichtigsten Herausforderungen, denen sich alle Industriegesellschaften in den nächsten Jahrzehnten bis etwa 2050 stellen müssen und die von einschlägigen Diagnosen nachdrücklich angemahnt werden.
Eine verstärkte Digitalisierung wird von der Mehrheit der Bevölkerung, besonders von Wirtschafts- und politischen Eliten, gefordert und vorangetrieben. Deutschland wird wegen seines vergleichsweisen digitalen Rückstandes etwa auf die skandinavischen und baltischen Länder immer wieder gerügt. Viele Protagonisten propagieren Digitalisierung sogar als technische Voraussetzung, um (non-fossile) Energien und Rohstoffe effizient und flexibel einzusetzen sowie Produktionsabläufe, Administrationen und Verteilungsmechanismen ressourcenschonend zu gestalten, zu beschleunigen, zu automatisieren, generell: um Energie einzusparen oder möglichst klimaneutral herzustellen und die Umwelt zu schonen. Nur wenige weisen darauf hin, dass solche Strategien und Aktivitäten erhöhten Energieverbrauch (vor allem Elektrizität) erfordern. Ob dieser enorme (wachsende) Bedarf allein aus alternativen, non-fossilen Quellen gewonnen werden kann, ist längst noch nicht ausgemacht. Ebenso verlangt die CO²-freie Energiegewinnung bis heute den vermehrten, extensiven Abbau von Rohstoffen (Lithium, seltene Erden etc.) etwa für Windräder, Solaranlagen, Batterien, der – zumal in Ländern des globalen Südens – neue gravierende Umweltprobleme verursacht und Menschenrechte ignoriert. Diese Schäden werden bislang kaum berücksichtigt. Stattdessen verlängert und modifiziert sich dadurch der kapitalistische Raubbau. Der ökologische Fußabtritt vergrößert sich mit jedem E-Auto und jedem Server. Allein eine vollständige Kreislaufwirtschaft, die strikt recycelt und zudem global angelegt ist, könnte Abhilfe schaffen. Aber: Ob sie in einer von Disparitäten und Konkurrenzen, von Krisen und Kriegen geschüttelten Welt jemals wirksam realisiert werden kann, ist fraglich.
Jedenfalls erweisen sich viele, auch vermeintlich fortschrittliche Postulate für Klimaschutz und Digitalisierung als unzureichend konzipiert und praktisch kaum realisierbar. Daher fordern radikalere Konzepte (z.B. Herrmann 2023) ein “grünes Schrumpfen” auf ein früheres Wohlstands- und Entwicklungsstadium, ähnlich der britischen Nachkriegswirtschaft. Andere implizieren Verzicht, artikulieren ihn jedoch nicht deutlich genug: “Die maßlose Benutzung und Ausnutzung von Mensch, Natur und Gesellschaft lässt sich wohl kaum mehr allein damit mildern oder gar stoppen, dass die einen sich einschränken und die anderen ihre Sorge-Aktivitäten ausweiten”, mahnt etwa S. Pfeiffer (2021: 288). „Wir werden nicht darum herumkommen, auch nach den systematischen Gründen zu fragen, die immer neue Monster schaffen und das systematische Kümmern um unerwartete Folgen nur dann erlauben, wenn sich daraus ein Geschäftsmodell machen lässt.” Doch für solche grundsätzliche Problematisierungen, Einschränkungen und Transformationsstrategien dürften (noch) kaum Zustimmungen und Mehrheiten zu gewinnen sein. Bislang orientiert sich alles auf weiteres, wenn möglich nachhaltiges oder qualitatives Wachstum. Daher lassen sich solche Restriktionen mutmaßlich nur durch Zwang, Kontrollen und Einschränkungen demokratischer Rechte erreichen, und national bringen sie in einer vernetzten Welt ohnehin kaum etwas. Außerdem dürften sie nicht ohne digitale Überwachungsmechanismen (Zuboff 2018) durchsetzbar sein, wie sie im heutigen China abschreckend wirkungsvoll erprobt werden. Demnach könnte sich eine breit angelegte, durchgängige Digitalisierung auch als kontraproduktiv erweisen – zumindest nach dem gegenwärtigen Stand der technologischen Entwicklung.
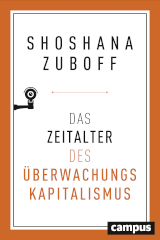

Zur analytischen Klärung scheint es im Folgenden hilfreich zu sein, die meist implizierten Begrifflichkeiten und ihre referierten Gegenstandsbereiche anhand maßgeblicher Literatur schrittweise zu rekonstruieren und damit Grundlagen für weitere theoretische Entwürfe und Diskussionen zu schaffen.
2. Digitalisierung und Digitalität
Entgegen der inzwischen selbstverständlichen und vermeintlich klaren Begrifflichkeit von Digitalisierung im alltäglichen Gebrauch, ist ihre analytisch-wissenschaftliche Semantik nach wie vor unscharf und umstritten. Diverse Positionen zur Digitalität als elementarem Status und zur Digitalisierung als vielfältigem Prozess verhandeln etliche Disziplinen (Altmeppen u.a. 2023, 23ff) und reichern sie mit verwandten und/oder konkurrierenden Kategorien an, wie Informatisierung (Nora/Minc 1979; Boes/Kämpf 2023), Vernetzung (Castells 2001ff), Mediatisierung, bzw. Datafizierung (Couldry/Hepp 2023), Plattformisierung (Snircek 2018; Seemann 2021; Dolata/Schrape 2023) oder Online-Kapitalismus (Haug 2020) etc. Heuristisch lassen sich mindestens zwei Bedeutungsräume unterscheiden: einen engen, vorrangig technisch geprägten bzw. reduzierten und einen weiten, gesellschaftstheoretisch untermauerten. Ersterer umschreibt gemeinhin die basale Funktion, nämlich die Umwandlung von analogen in digitale Zeichen (also auf binäre Codierungen) sowie den wachsenden Einfluss des Computers bzw. der IT-Technologie und des Internets auf sämtliche kommunikative Prozesse (Bleicher 2022). Viele sehen schon das Zahlensystem oder die Schrift bereits als digitale Chiffre, so dass ihre gegenwärtige (computer-)technische Formierung nur eine evolutionäre Weiterentwicklung, nicht aber ein radikaler Bruch wäre. Die weitere, in sich vielseitige Perspektive betrachtet und expliziert die digitalen Technologien als Motor oder als Markenzeichen für einen basalen Wandel der Industriegesellschaft. Für die Transformation in eine postindustrielle, datengetriebene und potenziell immaterielle Wirtschafts- und Handlungsweise, die womöglich noch grundsätzlicher und weitreichender als die so genannte “industrielle Revolution” des 19. Jahrhunderts sein wird, können die Visionen und Utopien für nicht weit und gründlich genug ausfallen (Nassehi 2019; Schrape 2021; Bundeszentrale 2022; Friesike/Sprondel 2022; Carstensen/Schaupp/Sevignani 2023).
Als “Paradoxon” bezeichnen die Eichstätter Kommunikationswissenschaftler, K.-D. Altmeppen u.a. (2023: 24), Digitalisierung. Einerseits wird sie als “Problem” gesehen, “das gegebene Ungleichheiten verfestigt und neue Ungleichheiten […] zwischen Gruppen innerhalb einer Gesellschaft, aber auch zwischen Individuen und Organisationen” produziert; andererseits wird “die Digitalisierung als Möglichkeit für mehr Demokratie, gesellschaftliche Teilhabe und Transparenz verstanden” wird (ebd.) – so wie sie auch schon der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung in seinem Gutachten zur Digitalisierung und Globalisierung (WBGU 2019: 1) beurteilte.
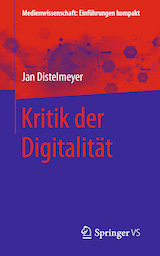

Sogar als “Zumutung”, die auf “Grundsätzliches” zielt, apostrophiert J. Distelmeyer (2021: 1) Digitalität, und zwar weil
- “der Begriff und die Gleichzeitigkeit der Präsenz und Verborgenheit von Bedingungen, Apparaten und Prozessen […] programmatische Wechselwirkungen” markieren;
- “mythische und materielle Faktoren” zusammenwirken;
- “unterschiedliche theoretische Ansätze zur Digitalität” beschritten werden;
- inzwischen “digital” und “vernetzt” gleichgesetzt werden (ebd.: 2).
Allerdings: Angesichts der umrissene kategorialen Felder dürfte eine einfache Pauschaldefinition von Digitalität, nämlich als “die Gesamtheit und Eigenart der Bedingungen und Folgen elektronischer Digitalcomputer in all ihren Formen” (ebd.) kaum mehr ausreichen.
Entsprechend der aktuellen Debatte fokussiert die Arbeitssoziologin S. Pfeiffer (2021: 9) nur noch die Prozesse der Digitalisierung, nämlich “einerseits [als] ein Bündel neuerer informationstechnologischer Artefakte und Technologien (von Künstlicher Intelligenz und Machine Learning über das Internet der Dinge bis zu neuen Ansätzen in der Robotik), andererseits [als] die Nutzung erwarteter Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft”. Hier stehen mithin Anwendungen und Nutzungsformen im Vordergrund, die noch der konkreten Füllung bedürfen.
Ungleich fundamentaler, nämlich gewissermaßen als evolutionäre, womöglich universale Entwicklung expliziert der Zürcher Kulturwissenschaftler F. Stalder (2021) Digitalität. Er fügt sogleich den ebenso polysemen Begriff der Kultur hinzu: “Die Entstehung und Ausbreitung der Kultur der Digitalität ist die Folge [nicht die Ursache! HDK] eines weitreichenden, unumkehrbaren gesellschaftlichen Wandels, dessen Anfänge teilweise bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen” (ebd, 11). In der Kultur schlägt er sich vor allem in drei Formen nieder, als
- “Referentialität, also die Nutzung bestehenden kulturellen Materials für die eigene Produktion”;
- “Gemeinschaftlichkeit“, denn “nur über einen kollektiv getragenen Referenzrahmen können Bedeutungen stabilisiert, Handlungsoptionen generiert und Ressourcen zugänglich gemacht werden”;
- “Algorithmizität, d.h, sie [die kulturelle Landschaft, HDK] ist geprägt durch automatisierte Entscheidungsverfahren, die den Informationsüberfluss reduzieren und formen, so dass sich aus den von Maschinen produzierten Datenmengen Informationen gewinnen lassen, die der menschlichen Wahrnehmung zugänglich sind und zu Grundlagen des singulären und gemeinschaftlichen Handelns werden können” (ebd.: 13).


Ähnlich umfassend, aber techniksoziologisch definiert der Stuttgarter Sozialwissenschaftler J.-F. Schrape (2021: 80ff.) Digitalisierung: nämlich als “inkrementellen Veränderungsprozess, der sich weder unabhängig von übergreifenden gesellschaftlichen Dynamiken noch losgelöst von den sozioökonomischen Bereichen verstehen lässt, in denen Digitaltechnik entwickelt und eingesetzt wird”. Digitalisierung ist also kein “disruptiver Bruch”, sondern
- ein “soziotechnischer Transformationsprozess“, „in dem jede Neuerung in ihrer Genese an zahlreiche technische und soziale Prämissen gekoppelt ist und wiederum mit vielfältigen gesellschaftlichen Umwälzungen einhergeht, welche die Ausgangsbasis für weitere Entwicklungsverläufe bieten”;
- eine Transformation mit einer “Initialzeit technischer Innovationen”, die sich “meist als eine Phase offener und kollaborativer Innovationstätigkeiten charakterisieren lässt, während sich mit der Verfestigung der jeweiligen soziotechnischen Prozesszusammenhänge regelmäßig Kommodifizierungs- und Kommerzialisierungsdynamiken einstellen, aus denen oft nur eine kleine Zahl marktbestimmender Unternehmen hervorgeht”;
- umfasst sich wandelnde Dynamiken, “die mit der überschaubaren Zahl an technikaffinen Frühnutzenden und schnell prosperierenden Unternehmen immer wieder Chancen und Impulse für weitreichende Zukunftserwartungen bieten und permanent weitere Wandlungsdynamiken bis hin zu Dezentralisierungen sozioökonomischer Verhältnisse generieren”. Allerdings bieten die “nachkommenden Kommerzialisierungsdynamiken […] ebenso regelmäßig Anlass für dystopisch eingefärbte Zeitdiagnosen, die u.a. führenden Infrastrukturanbietern eine Allmachtstellung zuschreiben, da sie zentrale Architekturen des sozialen Austauschs betrieben, kontrollieren und verwerten” (ebd.: S. 83).
Damit sind recht disparate Verständnisse von “Digitalisierung” und “Digitalität” avisiert, die weit über technische und technologische Verfahren und ihre operativen Anwendungen hinausreichen, mithin eine kultur- und gesellschaftstheoretische Definition des anhaltenden gesellschaftlichen Wandels unterstellen oder implizieren und damit für die ebenso generellen und/oder soziologischen Zuschreibungen des Wandels anschlussfähig sind. Weitere Einordnungen oder auch Zuspitzungen finden sich in ökonomisch fundierten Analysen.
3. Digitaler Kapitalismus: politikökonomische Analysen
In Gesellschaften wie der unsrigen – nämlich in kapitalistischen – liegt es nahe, den Strukturwandel wirtschaftlich oder politikökonomisch zu beschreiben oder zu erklären. Das geschieht unabhängig davon, ob man die Digitalisierung als technische und/oder technologische Triebfeder oder als Folge systemisch notwendiger oder zufälliger Veränderungen von Technik und Gesellschaft ansieht. Für solche Konzepte firmiert seit mehr als zwanzig Jahren der Terminus des “digitalen Kapitalismus”, der allerdings nicht weniger unterschiedlich konzeptualisiert ist und verwendet wird (Sevignani u.a. 2023: 26). Exemplarisch seien herausgegriffen:
Der amerikanische Kommunikationswissenschaftler D. Schiller prägte den Begriff des “Digital Capitalism” 1999. Für ihn ist das Internet, das seit den 1950er Jahren entwickelt und verbreitet wird, der technologische Schlüssel zu einem “economywide network that can support an ever-growing range of intracorporate and intercorporate business processes” (Schiller 1999: 1). Es ist also eine neue Form oder Stufe des globalen und (post-)industriellen Kapitalismus, die die technischen Innovationen vorantreibt und damit zwangsläufig auch gesellschaftliche Veränderungen auslöst. Als maßgebliche Akteure lassen sich Computer- und Telekommunikationsfirmen sowie einige transnationale Unternehmen ausmachen, die ihre Märkte erweitern und neue Geschäftsmodelle entwickeln wollen. Der neoliberale Staat unterstützt sie, um die herkömmlichen gesellschaftlichen Strukturen zu erhalten.
Schillers zweites Buch (2014) steht unter dem Eindruck der Finanzkrise 2007/2008 und heißt deshalb Digital Depression. Erneut haben sich Widersprüchlichkeit und Krisenanfälligkeit des Kapitalismus eingestellt, die auch nicht durch weltumspannende Technologien verhindert werden können. Daher müsse die Rolle der (neuen) Technologien jeweils innerhalb der zentralen ökonomischen Entwicklungen verortet werden, nicht umgekehrt; ihre Entwicklung ist mithin nachgeordnet.
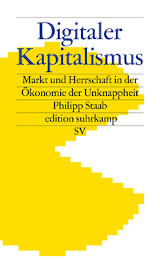

Der Berliner Arbeitssoziologe P. Staab (2019) knüpft an Schillers Analyse an, will gewissermaßen dessen Arbeiten fortschreiben, indem er aber den “analytischen Kern” des digitalen Kapitalismus herausarbeitet (ebd.: 14). Seine ökonomische Kernformationen sind “proprietäre Märkte”, die gleichermaßen nach Expansion wie nach Schließung streben. Dafür setzen sie im Wesentlichen vier Kontrollstrategien ein: Kontrolle der Marktdaten, der Marktzugänge, der Preise und der Bedingungen der Leistungserbringung. Dafür nutzen sie die jeweils effektivsten und umfassendsten digitalen Infrastrukturen wie Cloud, Künstliche Intelligenz und Finanztechnologie. Die dafür mächtigsten Akteure sind schnell ausgemacht: die globalen Internetkonzerne wie Alphabet (Google), Amazon, Meta (Facebook) und Apple, genannt GAFA, aber auch Microsoft (dann GAFAM) sowie die chinesischen Konzerne Alibaba und Tencent zählen dazu. Ihnen geht es letztlich um universale Märkte, “auf denen Produzenten agieren”, und um ökonomische Renten. Sie unterstützen die wachsende globale Macht des Finanzkapitals und die fortschreitende Finanzialisierung der gesamten Ökonomie. Am Ende steht eine “Ökonomie der Unknappheit”, zumindest innerhalb der proprietären Märkte und für ihre Produkte (ebd.).
Wie weit und wie schnell sich dieses Geschäftsmodell ausdehnt und welche Formen des Wirtschaftens daneben bestehen bleiben, zumal in einer sich polarisierenden Welt, lässt Staab offen, auch: wie eine Verstetigung gelingen kann und “worin die wertschaffende Qualität von Arbeit in einer von proprietären Märkten beherrschten Ökonomie besteht”, kommentiert S. Pfeiffer (2021: 43). Immerhin liefert Staab weiterführende und anschlussfähige analytische Kategorien. Die gegenwärtige Transformation interpretiert er als “eine noch unvollendete, aber möglicherweise dramatische Zäsur in der Entwicklung des Kapitalismus, der dadurch nicht verschwände, sondern sich in seinen Grundzügen radikalisierte” (Staab 2019: 27; vgl. auch Staab 2023: 312ff).
Krisenphänomene und -dynamiken erkennt S. Pfeiffer in ihrem Grundlagenwerk (2021) weniger in der Wertgenerierung, also in der Produktion, denn in der Wertrealisierung, also in der Distribution und Konsumtion, infolge von Überproduktion und Unterkonsumtion. Im Rückgriff auf Marx‘ (Mehr-)Werttheorie entwickelt sie als neue, prinzipielle Kategorie die “Distributivkraft” (analog zu Marx‘ Produktivkraft): Darunter fasst sie “erstens alle mit der Wertrealisierung verbundenen technologischen und organisatorischen Maßnahmen und Aktivitäten, deren Intention zweitens ist, diese Wertrealisierung möglichst garantiert immer weiter auszudehnen, auf Dauer zu sichern und dies mit möglichst geringen Zirkulationskosten” (ebd.: 16). Im Einzelnen betrachtet sie drei Distributivkräfte – oder eigentlich: Distributivkraftkomplexe – :
- Werbung und Marketing: alle strategischen Anstrengungen, die direkt auf die Wertrealisierung, also auf Konsum und Markt, zielen;
- Transport und Lagerung: alle logistischen Anstrengungen, um den physischen Zugang zu Märkten und zur Wertrealisierung zu gewährleisten;
- Steuerung und Prognose: alle kontrollierenden Anstrengungen, die Wertgenerierung und Wertrealisierung verknüpfen und in allen Zirkulationsbewegungen im wahrsten Sinne des Wortes berechenbar machen.
Alle drei Distributivkräfte hängen miteinander zusammen, überschneiden sich, entwickeln sich technisch-organisatorisch und in komplementärer Arbeitsteilung, fast immer in Wechselwirkung zueinander; sie sind aber nicht Treiber und “Ausdruck der Digitalisierung”, sondern ihr “begierigster Abnehmer”, also probateste Anwendungsfelder (ebd.: 25). Wenn man der anhaltenden Phase des Kapitalismus unbedingt einen Namen geben will, wäre der des Distributivkapitalismus angemessen. “Denn das eigentlich Neue verschiebt sich im Ökonomischen und nicht im Technischen.” Aber: “[e]ine Lösung für die Krisenanfälligkeit des Kapitalismus sind weder die Distributivkräfte noch ihre digitalisierten und digitalisierenden Erscheinungsebenen” (ebd.: 26).


Zur gegenteiligen Schlussfolgerung über den digitalen Kapitalismus kommt der Kulturwissenschaftler und Autor M. Seemann in seinem sondierenden Essay (Seemann 2019) den er nach Die Macht der Plattformen (2021), einer profunden Analyse der Politik der Internetgiganten verfasste. Ausgehend von fünf fundamentalen Kriterien des Kapitalismus aus der Sicht von Marx, nämlich dem Antagonismus von Kapital und Arbeit, der Steuerung der Wirtschaft durch den Markt, dem Privateigentum an den Produktionsmitteln, dem Vorherrschen einer Eigentumsordnung sowie dem Prinzip der Akkumulation (oder auch des Wachstums), befragt Seemann die sich abzeichnenden Formationen des digitalen Kapitalismus daraufhin, ob und inwieweit sich grundlegende Veränderungen in ihnen feststellen lassen, und kommt zu folgenden (vorläufigen) Resultaten: Hinsichtlich des Kapitals lassen sich bei “immateriellen Gütern” und “geistigem Eigentum” allenfalls “Monopolverwertungsrechte” oder – überspitzt – “Eigentumsbehauptungen” konstatieren. Hinsichtlich der “Arbeit” lassen sich unterschiedliche, wenn nicht widersprüchliche Theorien finden; Einigkeit besteht allenfalls darin, dass “Arbeit im klassischen Sinn zumindest nicht mehr der wesentliche Ort der Wertschöpfung ist” (ebd.: 12). Auch hinsichtlich des Marktes zeichnen sich Verschiebungen ab: Wenn sich der Markt als ein Informationssystem zwischen Angebot, Nachfrage und Preis verstehen lässt, dann erweisen sich heute “IT-Systeme der Anbieter […] einfach [als] intelligenter als der Markt” (ebd.: 13). Hinsichtlich des “Eigentums” lässt sich diagnostizieren, dass die wachsende Zahl der Plattformen bereits eine Form der Kontrolle darstellen, “die die Eigentumsordnung gar nicht braucht, sondern diese lediglich stellenweise abbildet. Das aber bedeutet nichts Geringeres, als dass im Digitalen das Rechtskonzept des Eigentums zumindest infrage steht” (ebd.: 14). Schließlich mutiert auch die Wachstumskategorie derart, dass sie in der digitalen Ökonomie lediglich bedeutet: Die Konsumentenrente wird erfolgreicher abgeschöpft, d.h., mehr Menschen müssen unnötigerweise mehr bezahlen, als sie unter “normalen Marktbedingungen” müssten (ebd.: 15). Seine letztlich “beunruhigende Frage” fasst Seemann so zusammen: “Ist ein digitaler Kapitalismus mit nur noch behauptetem Kapital und überflüssiger Arbeit, der nicht mehr durch den Markt gesteuert wird, die Eigentumsordnung hinter sich gelassen hat und dessen kaum noch vorhandenes Wachstum aus der künstlichen Verknappung von Immaterialgütern resultiert, noch Kapitalismus?” Die zögerliche Antwort lautet: “Vermutlich nein”. Und deshalb sollte man sich vergegenwärtigen, dass es sich “um eine komplett neue Form der Ökonomie handelt”, für die es noch keinen Namen gibt und von der noch weitgehend unbekannt ist, wie sie funktioniert: etwas, “das noch im Werden ist” (ebd.: 15).
Entgegen schon vielfach behaupteter Gewissheiten und vorgeblich stringenter Zeitdiagnosen über die digitale Gesellschaft (oder ihre diversen Epitheta) identifiziert J.- F. Schrape (2021) in seinem techniksoziologischen Studienbuch viele offene Prozesse der digitalen Transformation sowie vielfältige Veränderungen mit nur vorläufig “erkennbaren Dynamiken und Ambivalenzen” eines “langfristigen Verknüpfungszusammenhang von Technik und Gesellschaft”, dessen Ausgang, Tragweite, Struktur und Konfiguration noch nicht, wohl niemals abgeschlossen und eindeutig sind, geschweige denn in eine “abgeschlossene Theorie der Digitalisierung” gefasst werden können. Vielmehr dürfte es immer wieder auch unerwartete Rekonfigurationen, Umwege, Sackgassen und plötzliche Innovationen geben wie seither in der gesamten Technikentwicklung. Daher behandelt der Autor bevorzugt die folgenden drei Fragen: 1. “Wie wirken technische und soziale Prozesse auf den adressierten Feldern des Wandels ineinander?” 2. “Was ist das tatsächlich Neue an den jeweiligen soziotechnischen Veränderungsdynamiken?” 3. “Welche gesellschaftlichen Folgen und Konsequenzen gehen damit einher?” (ebd.: 11f), und er hofft mit ihrer Beantwortung, einen “orientierenden Korridor” in die “techniksoziologisch informierte Digitalisierungsforschung” zu eröffnen (ebd.: 13). Dafür untersucht Schrape kritisch die “Rekonfiguration gesellschaftlicher Koordinationsmuster” sowie den “Wandel gesellschaftlicher Kommunikations- und Öffentlichkeitsstrukturen”. Sämtliche Adaptions- und Aneignungsdynamiken sind dabei vom “Wechselspiel von Ermöglichung und Kanalisierung” (ebd.: 145) bzw. von Kontrolle geprägt. Eine einseitige, technisch bestimmte Determinierung oder ökonomische Dominanz wird den vielfältigen Ambivalenzen und Kontingenzen realer Entwicklungen, in die auch immer wieder subjektive Entscheidungen eingreifen, nicht gerecht.


Vielmehr listet Schrape als “tiefgreifende Um- und Neuordnungen” zahlreiche einzelne Aspekte auf: Im Markt reduzieren sich Transaktionskosten, sinken Eintrittsbarrieren, werden Vertriebsmöglichkeiten niederschwellig und ermöglichen im Grundsatz Dezentralisierung. Diese Optionen nutzen aber auch riesige, internationale und marktbeherrschende Plattformen, die Handel und Konsum kanalisieren. Auf dem Arbeitsmarkt lassen sich Beschäftigungsverhältnisse flexibilisieren, die die Autonomie des Einzelnen erhöhen (können), aber auch den qualifikatorischen Anspruch an und die psychische Belastung für sie/ihn intensivieren. Zugleich ermöglichen die digitalen Techniken unbemerkt strengere Überwachung, Standardisierung und Kontrolle von Arbeitsprozessen und lassen den Wettbewerbsdruck unter den Beschäftigten steigen. Organisationen können durch algorithmisierte Modellierung von Abläufen dezentraler, ortsungebundener und vor allem enthierarchisiert werden, aber es können auch unbemerkt Entscheidungsspielräume eingeschränkt und Entscheidungsroutinen technisch reformalisiert werden. In den Außenverhältnissen von Unternehmen und Organisationen formieren sich erweiterte und flexiblere Kooperations- und Austauschstrukturen, die sogar zu projektorientierten Kollaboration bei Innovationen und Marktentwicklung führen. Sobald sie allerdings für den Markt und die Verwertung interessant werden, verlieren sie oft ihren offenen Charakter und ihre Nischenspontaneität. Schließlich verändert die fortschreitende digitale Transformation die Bedingungen für die Genese und Stabilisation kollektiver Formationen, wie sich an vielen gegenwärtigen Gruppierungen wie Occupy Wallstreet, #MeToo, Fridays for Future etc. exemplifizieren lässt. Mittels der Social-Media-Plattformen lassen sich schnell Gleichgesinnte mobilisieren, organisieren und steuern, allerdings lassen sich ihre Aktivitäten ebenso leicht beobachten, kanalisieren, kontrollieren und sogar beeinflussen. So reproduzieren sich bei der gesamten Digitalisierung grundsätzlich soziologische Erkenntnisse über genuin soziale Prozesse, Organisationen und Institutionen, wie sie auch durch die neuen informationstechnischen Strukturen und Potentiale enorm intensiviert und kontingenter geworden sind.
Wie kaum ein anderer gesellschaftlicher Sektor wandelt und revolutioniert sich die gesellschaftliche und individuelle Kommunikation, da sie zudem permanenter Spiegel der realen Umwälzungen verkörpert und gewissermaßen sie in einer zweiten, der Medienwelt reflexiv (re-)konstruiert. Gleichwohl lässt sich bislang keine “radikale Erosion aller langfristig stabilisierter Prozesszusammenhänge” konstatieren (ebd.: 196), wie es vielfach in der überbordenden sozialwissenschaftlichen Beobachtung befürchtet wird. Vielmehr sind tiefgreifende Transformationsprozesse im Gange, die durch das vielschichtige “Ineinanderwirken eingespielter und neuer Medienformen” geprägt sind (ebd.), wie Schrape sie mit vielen empirischen Daten, aber auch im Rekurs auf explikative theoretische Ansätze breit belegt. Im Einzelnen führt er “eine zunehmende Plattformisierung der Medienstrukturen, eine Individualisierung der Medienrepertoires, eine Pluralisierung der Öffentlichkeitsarenen, ein verändertes Verhältnis sozialer und technischer Strukturierungsleistungen in der Aushandlung öffentlicher Sichtbarkeit sowie eine Dynamisierung gesellschaftlicher Wirklichkeitskonstruktion” an (ebd.: 149). Damit haben sich Möglichkeitsräume für persönliche Interaktionen bzw. Kommunikationen sowie für den öffentlichen Austausch via Social Media enorm erweitert und vervielfältigt. Auf der anderen Seite “erhöht sich mit der Heterogenität der Arena öffentlicher Kommunikation” (ebd.: 199) gleichermaßen der Bedarf für erwartungssichere Verfahren der Komplexitätsreduktion auf gesellschaftsumspannender Ebene. Nach wie vor befriedigt der professionelle Journalismus diese am besten, wie immer er von digitaler Informationstechniken unterstützt, begleitet und substituiert wird. Wie sich diese Komplementär- und Konkurrenzverhältnisse auf Dauer arrangieren – vermutlich territorial, sektoral und kulturell unterschiedlich – werden künftige, offene Entwicklungen weisen und muss empirisch eruiert werden (vgl. auch Seeliger/Sevignani 2021).
Als “eine noch relativ neue Dimension des Kapitalismus und der kapitalistischen Akkumulationsprozesse” bezeichnet der Paderborner Medienökonom Ch. Fuchs (2023a: 471) den “digitalen Kapitalismus”. In ihm würden “Prozesse der Kapitalakkumulation, der Entscheidungsmacht und der Reputation mit Hilfe digitaler Technologien vermittelt und organisiert”, charakterisiert er pauschal, wodurch “digitale Waren und digitale Strukturen” entstehen (ebd.: 467). Mit den bereits erreichten oder zumindest angestrebten Differenzierungen anderer Konzepte können diese allgemeinen Ausführungen nicht mithalten. Folglich mahnt Fuchs weitere Forschungen innerhalb einer “interdisziplinären kritischen” Gesellschaftstheorie an (ebd.: 471). In einem seiner jüngsten Beiträge (Fuchs 2023b) gibt sich Fuchs schon dezidierter und charakterisiert den digitalen Kapitalismus als eine weitere “Dimension” neben vielen andere “Kapitalismen” (ebd.: 182f) wie den Finanz-, den fossilen oder “hyperindustriellen Kapitalismus”. Eine neue gesellschaftliche Formation mit speziellen Akkumulationslogiken und Produktionsverhältnissen, wie Staab (2019) den digitalen Kapitalismus kennzeichnet, vermag Fuchs nicht zu erkennen. Vielmehr werden in ihm die “Prozesse der Kapitalakkumulation, der Akkumulation von Entscheidungsmacht und der Akkumulation von Reputation mit der Hilfe digitaler Technologien vermittelt und organisiert […]” (ebd.: 180). Eine Verabsolutierung des “digitalen Kapitalismus” und mithin als Anerkenntnis einer weiteren Stufe der kapitalistischen Entwicklung negiert Fuchs (ebd. 186).


Der kürzlich erschienene Sammelband Theorien des digitalen Kapitalismus (2023) von T. Carstensen, S. Schaupp und S. Sevignani, fasst das mögliche theoretisch-analytische Spektrum sehr weit. Mit der Einleitung der Herausgebenden und 25 Beiträgen schreitet der Reader absichtlich einen weiten analytischen Horizont ab, wobei sich etliche Beiträge allenfalls verhalten oder kaum explizit zum “digitalen Kapitalismus” erklären und nur wenige ihn als selbstverständlich verwenden. So kommt in der Tat eine “Zusammenschau einzelner Aspekte und Veränderungen in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen” (Sevignani u.a. 2023: 9) zustande, die sich grob unter die marxistischen Kategorien der Produktivkräfte (Arbeit), Arbeitsorganisation (Ökonomie), Wertschöpfung sowie politische und kulturelle Regulation subsumieren lassen. Denn nach wie vor sind die Dimensionen und analytische Zugänge des “digitalen Kapitalismus” “widersprüchlich, facettenreich und (regional) verteilt” zu fassen, wie es weiter in der Einleitung (ebd.: 26) heißt, zumal wenn man die “kulturelle Regulation” und die “Subjekte” analytisch hinzufügt. Welche Deutungen dort “hegemoniefähig” sind, dürfte breit “umstritten und kulturell umkämpft” sein, wie die einschlägigen Beiträge aufweisen (ebd.). Daher muss man sich vorerst mit “Konturen gegenwärtigen Wandels kapitalistischer Gesellschaften” (ebd.: 9) zufriedengeben, wie immer man sie übergreifend bezeichnen will, resümieren die Herausgebenden. Dazu leistet ihr Reader breite, theoretisch pluralistische Pionierarbeit, die durch “zukünftige Analysen” (ebd.: 39) der adressierten gesellschaftliche Bereiche und Fragestellungen erweitert werden soll.
4. Ökologische Kosten und schwindende Nachhaltigkeit
Wäre die IT-Branche ein Land, stünde es schätzungsweise auf Platz sechs der CO²-Emittenten, noch vor Deutschland, war kürzlich in der ZEIT (Pinzler 2023) zu lesen. Denn die digitale Industrie und der digitale Verbrauch – wie immer man sie einigermaßen präzise berechnet – verursachen zwischen zwei und drei Prozent des globalen CO²-Ausstoßes. Beide wachsen rasant weiter. In den Jahren von 2010 bis 2023 verzehnfachte sich das Datenvolumen, bis 2027 könnte es sich verdreißigfachen. Mit der anstehenden Verbreitung von Künstlicher Intelligenz explodieren der Strombedarf und damit auch der CO²-Ausstoß, solange der Strom nicht gänzlich von erneuerbaren Quellen kommt. Jedenfalls brauchen die komplexen Algorithmen gigantische Server. Schon jetzt verursacht eine Anfrage bei der neuesten ChatGPT-Version etwa tausendmal so hohe Kosten wie eine Google-Anfrage (ebd.). Allein in den vergangenen zehn Jahren hat sich der Energie- und Rechenaufwand, der notwendig ist, um ständig präzisere Modelle zu bekommen, alle dreieinhalb Monate verdoppelt, so jüngste Schätzungen. Beispielsweise verbraucht der Konzern Alphabet mehr Strom als die gesamte Volkswirtschaft Sri Lankas. Auch der Verbrauch von Wasser, um die Kühlung der Server zu bewerkstelligen, ist enorm und steigt ständig. Gerade Wasser wird infolge der steigenden Temperaturen und der einhergehenden Dürre eine zunehmend rare und umkämpfte Ressource. Schon jetzt zeichnen sich in vielen südlichen Ländern und auch in den USA existentielle Konflikte ab (Sevignani u.a. 2023: 37). Doch die tonangebende Politik spielt diesen exorbitanten Ressourcenbedarf und -zuwachs herunter und schwärmt weiterhin von der steigenden Energieeffizienz und Nachhaltigkeit durch expandierende Digitalisierung, optimierte Steuerung und vor allem Künstlicher Intelligenz.
Die Transformation von Industrie- und vor allem Stahlproduktionen mittels “grünem Wasserstoff”, E-Mobilität, Gebäude-Heizungen mit elektrischen Wärmepumpen und endlich die rasant fortschreitende Digitalisierung mit Big Data, Clouds und Künstlicher Intelligenz – all das braucht immense Volumina an elektrischer Energie, die bislang weder mit der noch fossilen und erst recht noch nicht mit der erneuerbaren Produktion verfügbar ist. Schon 2019 verbrauchte Deutschland pro Jahr gigantische 12.779 Petajoule an Energie (Herrmann 2023: 163); allerdings ist der Verbrauch 2022 um 4,7 Prozent auf 11.829 Petajoule beziehungsweise auf 403,6 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten (Mio. t SKE) gefallen (https://ag-energiebilanzen.de). Gründe dürften kurzfristige verhaltensbedingte Einsparungen wie auch Energieeffizienzinvestitionen mit mittel- bis langfristiger Wirkung sein. Ferner minderten preisbedingte Produktionskürzungen in einzelnen Wirtschaftsbranchen – auch durch die epidemiebedingten Wachstumsminderungen – sowie die wärmere Witterung in 2021 die Energienachfrage (ebd.), die mit florierender Konjunktur und angeforderten Wachstumsraten wieder steigen wird.
Deshalb dürfte Elektrizität auf Dauer “knapp und teuer” bleiben (Herrmann 2023: 162), zunächst in jedem Fall im Übergang zur Vollversorgung mit erneuerbaren Energien, wenn Kohle, Gas und (inzwischen wieder oder immer noch) in etlichen Länder Kernkraft die Lücken ‘überbrücken’ müssen, aber auch im Endstadium mit wachsendem Verbrauch, wenn Ausfallrisiken durch riesige Speicher kompensiert werden sollen. Daher verlangt die Wirtschaftsredakteurin der taz, U. Herrmann, so schnell wie möglich eine Halbierung des Energieverbrauchs – und entsprechend ähnliche Größenordnungen für das wirtschaftliche Wachstum, für Produktion und Konsum (ebd.: 165). Selbst Energieeinsparungen und -effizienz etwa durch Digitalisierung – schon gepriesen als “grünes, zumindest qualitatives Wachstum” – werden aus ihrer Sicht nicht reichen, die gesamte Wirtschaft in ihrer jetzigen Form und mit einem auch nur geringen, für den gegenwärtigen kapitalistischen Bestand erforderlichen Wachstum zu befeuern. Vielmehr sind Verzicht, Rückbau oder “grünes Schrumpfen” (ebd.: 199) angesagt – eine sicherlich bislang noch äußerst rare, kaum akzeptierte Vision. Immerhin scheint die bundesdeutsche Politik mögliche Grenzen des Verbrauchs elektrischer Energie bereits zu vergegenwärtigen: Ab 1. Januar 2024 können Betreiber von Stromnetzen den Energieverbrauch von neuen, steuerbaren Wärmepumpen oder Ladestationen vorübergehend drosseln, wenn eine Überlast des Stromnetzes droht, so geregelt im neuen Paragrafen 14a des Energiewirtschaftsgesetzes.
Auch die nötigen Rohstoffe für die Hardware der digitalen Geräte und für die Daten- und Netz-Infrastruktur sind nicht unbegrenzt verfügbar. Zwar sind die konventionellen Ressourcen wie Stahl, Beton und Aluminium noch reichlich vorhanden oder produzierbar, wenngleich ihre Herstellung bereits jetzt sehr umweltschädlich ist. Aber für die gesamte digitale Technologie sind zudem knappe Mineralien wie Lithium, Nickel, Kupfer, Kobalt, Mangan, Grafit und seltene Erden nötig, die für ihre Weiterverwendung ebenfalls enormen Energiemengen einfordern: Smartphones, Laptops und Tablets brauchen beispielweise Lithium ebenso wie Batterien, Windräder und E-Autos (ebd.: 156). Diese Mineralien werden schon jetzt unter großenteils umweltzerstörendenden und menschenunwürdigen Konditionen vor allem in Ländern des globalen Südens wie im Anden-Dreiländereck Chile, Bolivien und Argentinien abgebaut. Wenn die Nachfrage steigt, wird der Abbau aufwendiger, kostenintensiver, teurer und letztlich begrenzter – solange es keine technologische Innovation und/oder kein nennenswertes Recycling der Altgeräte gibt. So schätzt die Internationale Energieagentur, dass die Nachfrage nach Lithium in der nächsten Dekade um das 42fache, bei Grafit um das 25fache, bei Kobalt um das 21fache, bei Nickel um das 19fache und nach den seltenen Erden um das Siebenfache steigen dürfte. Selbst Kupfer dürfte um mehr als das Doppelte nachgefragt werden (ebd.). Aber diese Rohstoffe werden ständig knapper, so dass geopolitische Konflikte drohen. Außerdem wachsen am Ende der Produktions- und Konsumtionsprozesse die Berge von Schrott und Müll in den armen Regionen, in denen sie angehäuft werden. Und da in den Rohstoffen vielfach giftige Abfallprodukte stecken, steigen die Risiken für die Gesundheit der dort lebenden Bevölkerungen und für die gesamte Umwelt. Kinder, die in diesen Schutthaufen nach noch etwas Verkaufbarem suchen, verkörpern das lebensgefährliche Menetekel des digitalen Booms (Meckel/Steinacker 2024: 259ff). All diese und noch etliche andere – nur schätzbaren – Trends indizieren nachdrücklich, dass sich die anstehende Transformation primär der hochentwickelten Industriegesellschaften nicht nur auf Digitalisierung, Datafizierung und den horrenden Einfluss amerikanischer IT-Konzerne fokussieren lässt, sondern tatsächlich die gesamte wachstums- und konsumfixierte Lebensweise in Frage stellt, eine “schöpferische Disruption” ansteht (um den viel verwendete Terminus von Joseph Schumpeter [1942] zu bemühen), zumal wenn die nachhaltige Erziehung und Bildung der nachfolgenden Generationen auf den Plan kommt (Barth 2023).
Daher ringen zeitgemässere Konzepte (wie das von den praktischen Philosophinnen, N. Fraser und R. Jaeggi [2021]) um ein “neues Verständnis des Kapitalismus”, das außer dem traditionellen Widerspruch von Kapital und Arbeit “neue Paradigmen” wie die des “Feminismus, der Ökologie und des Postkolonialismus” integriert und “zugleich die jeweiligen blinden Flecke jedes einzelnen vermeidet” (ebd.: 25). Fraser und Jaeggi identifizieren vier weitere “strukturelle Spaltungen und institutionelle Trennungen”, nämlich die zwischen “ökonomischer Produktion” und “sozialer Reproduktion”, zwischen “Wirtschaft” und “Gemeinwesen”, zwischen “menschlicher und nicht-menschlicher Natur” und endlich zwischen Ausbeutung und Enteignung als kolonialistische Dimension. Jeweils gilt es ihre Gewichtungen, Interrelationen und Widersprüche analytisch auszuloten, ohne wieder in die traditionelle ökonomistische Determination zu verfallen (ebd.: 81). Besonders die Dichotomie zwischen Natur und Menschheit bedarf nach Frasers Ansicht einer weiteren analytischen Betrachtung, zunächst dahingehend, dass Natur “denaturalisiert” und in die Gesellschaftstheorie historisiert einbezogen wird. Erst dadurch lassen sich ihr Beitrag zum Wohlstand einer Gesellschaft neben der Arbeit und ihre Funktion als ökologische Resilienz gegenüber der kapitalistischen Akkumulation ermessen. Ihr Raubbau lässt sich dann als Teil kapitalistischer Ausbeutung begreifen (ebd.: 131ff).
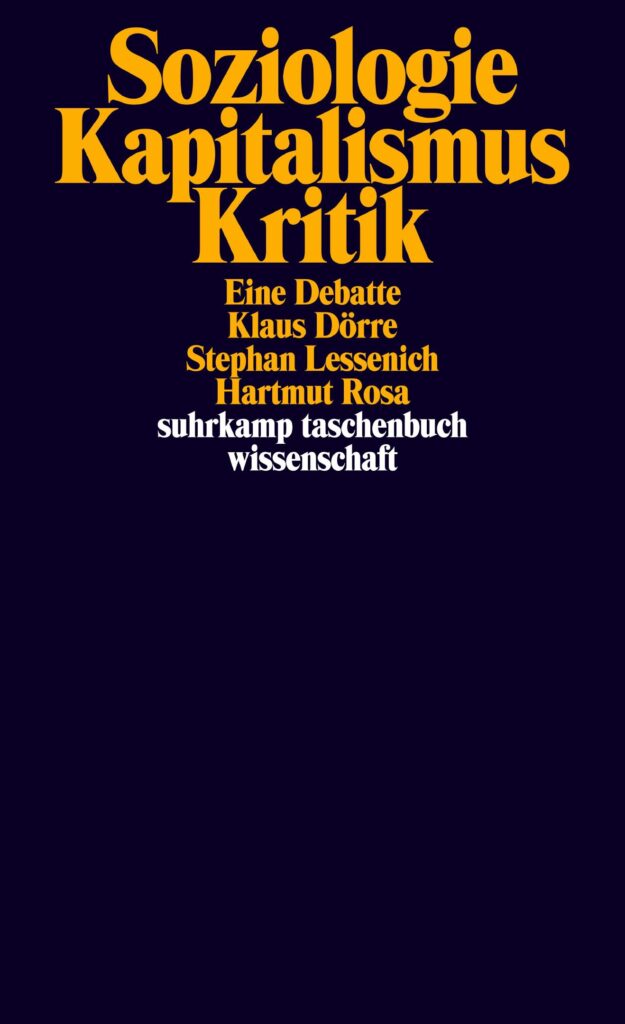

Ebenso plädiert der Jenaer Soziologe, K. Dörre (2017: 21ff., 245ff.), in seinem (vorläufigen) “Landnahmekonzept”, das auf Positionen von Rosa Luxemburg und Hannah Arendt rekurriert, dafür, das jeweils “qualitativ Neue kapitalistischer Vergesellschaftung” wahrzunehmen, da der Kapitalismus, “um funktionieren zu können, periodisch einer politischen Kraft [bedarf], die die ökonomischen ‘Gesetzmäßigkeiten’ bricht”. In “politikhaltigen Transfermechanismen, die eine Übertragung der finanzkapitalistischen Wettbewerbslogik auf völlig anders strukturierte gesellschaftliche Bereiche leisten” (ebd.: 247f.), sieht Dörre Chancen der “systemimmanenten Transformation des Kapitalismus” (ebd.: 82) als auch der “Systemtransformation” als ganze, mit welchem Ausgang auch immer (ebd.: 83). Insbesondere verlange die globale ökologische Bedrohung nach solchen Mechanismen und Strategien. Die “finanzkapitalistische Wettbewerbslogik” habe die “ökologische Frage” lange verdrängt und für ihre Dispensierung oder eher nur Eindämmung vorrangig auf Marktmechanismen gesetzt. Nun kehre das Verdrängte mit “umso größerer Wucht” zurück. “Im günstigsten Fall könnte ein ökologischer New Deal mit dem ‘Staat als Pionier’ die Weichen für gigantische Investitionsprogramme (Nutzung der Solaranergie, Erhöhung der Nutzungseffizienz) stellen und so überschüssiges Kapital in den tertiären Kreislauf, in drängende Infrastrukturinvestitionen leiten” (ebd.). Vielleicht könnte ein so verstandener “ökosozialer Kapitalismus” (ebd.) für die “vorläufige Rettung” und/oder für gründliche Reformen des Systems sorgen. Aber sicher sei diese Perspektive angesichts der historisch neuen, globalen Herausforderungen nicht, wie die Kämpfe in den Industrie- und Schwellenländern und die wachsenden Trends für rechtspopulistische Einfachlösungen und konservative Bewahrung allenthalben zeigen, von imperialen und kolonialistischen Eroberungen und Okkupationen ganz zu schweigen.
Wie man Digitalisierung und Nachhaltigkeit “zusammendenken” kann und muss, dazu hat der Frankfurter Soziologe T. Barth (2023) kürzlich einen umfassenden und differenzierten Ansatz vorgelegt. Eingangs verweist er darauf, dass schon 2019 der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung in seinem Sondergutachten “Unsere gemeinsame digitale Zukunft” (WBGU 2019) die vorliegenden Vorstellungen zur digitalen Zukunft als “digitales Dystopia” bezeichnete (ebd.: 290ff). Denn entgegen den optimistischen Erwartungen der Ressourceneinsparungen durch Effizienzgewinne, der Eindämmung des Klimawandels und dem optimierten Management von Ökosystemen durch digitale Steuerungen und der digital ermöglichten Konsumwende wiegen die sich abzeichnenden Probleme, Behinderungen und Widerstände schwer: Die schon beschriebenen Bedarfszuwächse an Ressourcen und Energie dürften die ökologisch-sozialen Spannungen in den kapitalistischen Zentren selbst sowie insbesondere zwischen ihnen und den weniger entwickelten Regionen massiv verschärfen, wofür die gegenwärtigen Kriege bereits verheerende Indikatoren sind. Die ökologische Verwundbarkeit des globalen Südens bis hin zu seiner existentiellen Vernichtung durch die Klimakrise steigt, seine wirtschaftliche Leistungskraft durch abbrechende Wertschöpfungsketten, De-Industrialisierung und sinkende Erträge in der Nahrungsproduktion und Landwirtschaft sinkt, und damit verschärfen sich sozial-ökologische Ungleichheiten und weltweite Migrationsbewegungen. Diese Kette nichtnachhaltiger Gegenkräfte und -trends ließe sich für alle Sektoren kapitalistischer Wirtschaft und Gesellschaft fortführen und schließt die Produktion, den Konsum und letztlich den Abfall digitaler Geräte und Infrastrukturen ein, so dass das ernüchterte Fazit nur lauten kann: “Die Digitalisierung ist momentan keine Lösung für die umfassende Nachhaltigkeitskrise, sondern verschärft sie sogar noch” (ebd.: 234). Folglich plädiert Barth zusammen mit anderen vorrangig für eine “große Emanzipation” (ebd.: 242) und weniger für weitere reformerische Transformationen. Diese seien primär an die Subjekte adressiert, aber nicht an die Verhältnisse.
Literatur:
Altmeppen, Klaus-Dieter; Nölleke-Przybylski, Pamela; Klinghardt, Korbian; Zimmermann, Anna: Digitale Medienökonomie. Baden-Baden [Nomos] 2023
Barth, Thomas: Nachhaltigkeit im digitalen Kapitalismus? In: Carstensen, Tanja; Schaupp, Simon; Sevignani, Sebastian (Hrsg.): Theorien des digitalen Kapitalismus. Arbeit, Ökonomie, Politik und Subjekt. Berlin [Suhrkamp] 2023, S. 224–242
Bleicher, Joan Kristin: Grundwissen Internet. Perspektiven der Medien- und Kommunikationswissenschaft. München [UVK Verlag] 2022
Boes, Andreas; Kämpf, Tobias: Informatisierung und Informationsraum: Eine Theorie der digitalen Transformation. In: Carstensen, Tanja; Schaupp, Simon; Sevignani, Sebastian (Hrsg.): Theorien des digitalen Kapitalismus. Arbeit, Ökonomie, Politik und Subjekt. Berlin [Suhrkamp] 2023, S. 141–164
Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Digitale Gesellschaft. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, 72. Jg., 10-11/2022. Bonn [Bundeszentrale für politische Bildung] 2022
Carstensen, Tanja; Schaupp, Simon; Sevignani, Sebastian (Hrsg.): Theorien des digitalen Kapitalismus. Arbeit, Ökonomie, Politik und Subjekt. Berlin [Suhrkamp] 2023
Castells, Manuel: Das Informationszeitalter. 3 Bde. Opladen [Leske & Budrich] 2001, 2002, 2003
Castells, Manuel: Die Internet-Galaxie. Internet, Wirtschaft und Gesellschaft. Wiesbaden [Verlag für Sozialwissenschaften] 2005
Couldry, Nick; Hepp, Andreas: Die mediale Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Mediatisierung und Datafizierung. Wiesbaden [Springer Fachmedien] 2023
Distelmeyer, Jan: Kritik der Digitalität. Wiesbaden [Springer Fachmedien] 2021
Dolata, Ulrich; Schrape, Jan-Felix: Politische Ökonomie und Regulierung digitaler Plattformen. In: Carstensen, Tanja; Schaupp, Simon; Sevignani, Sebastian (Hrsg.): Theorien des digitalen Kapitalismus. Arbeit, Ökonomie, Politik und Subjekt. Berlin [Suhrkamp] 2023, S. 344 – 363
Dörre, Klaus: Die neue Landnahme. Dynamiken und Grenzen des Finanzmarktkapitalismus & Landnahme, sozialer Konflikt. Alternativen – (mehr als) eine Replik. In: Dörre, Klaus; Lessenich, Stephan; Rosa, Hartmut (2017): Soziologie – Kapitalismus – Kritik. Eine Debatte. 5. Aufl. Frankfurt/M. [Suhrkamp] 2017, S. 21 – 86; S. 245 – 264
Fraser, Nancy; Jaeggi, Rahel: Kapitalismus. Ein Gespräch über kritische Theorie. 2. Aufl., Berlin [Suhrkamp] 2021
Friesike, Sascha; Sprondel, Johanna: Träge Transformation. Welche Denkfehler den digitalen Wandel blockieren. Ditzingen [Reclam] 2022
Fuchs, Christian: Grundlagen der Medienökonomie. Medien, Wirtschaft und Gesellschaft. München [UVK] 2023a
Fuchs, Christian: Anmerkungen zum Begriff des digitalen Kapitalismus. In: Carstensen, Tanja; Schaupp, Simon; Sevignani, Sebastian (Hrsg.): Theorien des digitalen Kapitalismus. Arbeit, Ökonomie, Politik und Subjekt. Berlin [Suhrkamp] 2023, S. 165 – 186
Haug, Wolfgang Fritz: Warum wir vom Online-Kapitalismus sprechen. Editorial zu Das Argument 335, 2020, S. 3ff.
Herrmann, Ulrike: Das Ende des Kapitalismus. Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind – und wie wir in Zukunft leben werden. Bonn [Bundeszentrale für politische Bildung] 2023
Nassehi, Armin: Muster. Theorie der digitalen Gesellschaft. München [C. H. Beck] 2019
Nora, Simon; Minc, Alain: Die Informatisierung der Gesellschaft. Frankfurt/M. [Juventa] 1979
Meckel, Miriam; Steinacker, Léa: Alles überall auf einmal. Wie Künstliche Intelligenz unsere Welt verändert und was wir dabei gewinnen können. Hamburg [Rowohlt] 2024
Pfeiffer, Sabine: Digitalisierung als Distributivkraft. Über das Neue am digitalen Kapitalismus. Bielefeld [transcript] 2021
Pinzler, Petra: Ist Surfen schmutziger als Fliegen? Die Digitalisierung hat ein grünes Image. Dabei sorgt das Internet für einen rasanten Anstieg der CO²-Emissiopnen. Doch die Politik redet nicht gern darüber. In: DIE ZEIT, Nr. 35, 17. August 2023, S. 5
Schiller, Dan: Digital Capitalism. Networking the Global Market System. Cambridge, Mass. [MIT Press] 1999
Schiller, Dan: Digital Depression. Information Technology and Economic Crisis. Cambridge [University of Illinois Press] 2014
Schrape, Jan-Felix: Digitale Transformation. Bielefeld [transcript Verlag] 2021
Schumpeter, Joseph A.: Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie. 20. Aufl. Tübingen [Narr Francke Attempto Verlag] 1942; 2020
Seeliger, Martin; Sevignani, Sebastian (Hrsg.): Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit? Baden-Baden [Nomos] 2021
Seemann, Michael: Eine beunruhigende Frage an den digitalen Kapitalismus. In: Aus Politik und Zeitgeschichte: Datenökonomie, 69, 24-26/2019, S. 10 – 15
Seemann, Michael: Die Macht der Plattformen. Politik in Zeiten der Internetgiganten. Berlin [Ch. Links Verlag] 2021
Sevignani, Sebastian; Schaupp, Simon; Carstensen, Tanja: Einleitung: Basiskategorien und zukünftige Herausforderungen für eine Theorie des digitalen Kapitalismus. In: Carstensen, Tanja; Schaupp, Simon; Sevignani, Sebastian (Hrsg.): Theorien des digitalen Kapitalismus. Arbeit, Ökonomie, Politik und Subjekt. Berlin [Suhrkamp] 2023, S. 9–42
Srnicek, Nick: Plattform-Kapitalismus. Hamburg [Hamburger Edition] 2018
Staab, Philipp: Digitaler Kapitalismus. Markt und Herrschaft in der Ökonomie der Unknappheit. Berlin [Suhrkamp] 2019
Stalder, Felix: Kultur der Digitalität. 5. Aufl. Berlin [Suhrkamp] 2021
Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU): Unsere gemeinsame digitale Zukunft. Berlin [Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung] 2019
Zuboff, Shoshana: Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus. Frankfurt/M. [Campus Verlag] 2018
Empfohlene ZitierweiseDigitalisierung und Nachhaltigkeit – Antipoden der strukturellen Transformation?. in rezensionen:kommunikation:medien, 23. Oktober 2024, abrufbar unter https://www.rkm-journal.de/archives/25066
