Rezensiert von Stephan Mündges
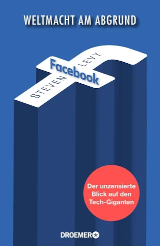

Um es gleich vorweg zu nehmen: das Buch liefert keine grundlegenden neuen Erkenntnisse über Facebooks Fehlverhalten in den vergangenen Jahren. Wer das Unternehmen und die Berichterstattung darüber beobachtet, kennt die im Buch noch einmal wiedergegebenen Skandale, von denen es mittlerweile so viele gibt: von Fragen aus der Anfangszeit danach, ob Zuckerberg Geschäftspartner übergangen haben könnte, über frühe Datenschutzskandale um den Facebook Beacon (ein Zählpixel, das Facebook-Nutzer auch auf anderen Webseiten verfolgte) bis hin zur Hate Speech- und Fake News-Apokalypse ab 2016 samt neuen Datenschutzskandalen, allen voran den Skandal um Cambridge Analytica.
Levy zeichnet das Bild einer Firma, die vor allem eins interessiert: Wachstum. Die ganze Welt sollte Facebook-Land werden. Die Kollateralschäden, die man auf dem Weg zur globalen Dominanz anrichtete, ignorierte Facebook für gewöhnlich. Erst wenn der öffentliche Druck zu groß wurde, zeigte man sich zuerst überrascht: Damit haben wir nicht gerechnet. Sorry! Dann ging man zaghaft Veränderungen an. Zumindest so lange es das Geschäft nicht gefährdete. Dabei hätte Facebook in mehreren Fällen damit rechnen müssen, dass die Plattform und ihre Features missbraucht werden würden. Vor der Wahl Trumps gab es Warnhinweise auf Desinformationskampagnen. Vor der Einführung von Livestreams auf Facebook gab es Stimmen, die darauf hinwiesen: Die Streams können auch für verstörende Inhalte wie Selbstmorde oder Vergewaltigungen genutzt werden. Immer tat Facebook solche Sorgen ab (vgl. 527). Sie hätten auch dem Wachstum getreu dem Motto “Move fast and break things” im Wege gestanden. Ich selbst habe diese Haltung Facebooks erlebt: Bei einem Hintergrundgespräch deutscher Journalisten mit führenden Facebook-Mitarbeitern in Europa kam die Frage auf, wie Facebook denn mit Hassrede und Desinformation umgehen wolle, die in geschlossenen Gruppen gepostet würde. Dort also, wo nicht die gesamte Öffentlichkeit hinblicken konnte, wo sich aber dennoch häufig hunderte, teils tausende Nutzer tummelten. Facebooks Antwort: man vertraue auf die Nutzer, solche Inhalte auch in geschlossenen Gruppen zu melden. Dass in einer geschlossenen, von Rechtsextremen geführten Gruppe niemand rassistische Bilder oder Postings melden würde – auf diesen Gedanken kamen die Facebook Executives nicht. Wie fahrlässig diese Haltung war, zeigte der Tagesspiegel später in einer investigativen Recherche (Wergener, 2016).
Levy arbeitet diese bewusst eingegangenen Fahrlässigkeiten an zahlreichen Stellen im Buch auf. Er weist dabei auf Widersprüche, in denen sich Facebook verzettelt, hin. Dabei bleibt er aber stets in der Rolle des Berichterstatters, lässt sich nicht hinreißen zu einer allzu prägnanten Bewertung. Die bleibt dem Leser überlassen.
Seine Stärken zeigt das Buch, wenn es von den handelnden Akteuren und ihre Beziehungen miteinander handelt. Wenn er die Reaktionen der Führungsriege Facebooks auf die Krise des Unternehmens nach dem Cambridge Analytica-Skandal beschreibt (vgl. 556 ff.) oder Mark Zuckerbergs Fehde mit dem Apple-CEO Tim Cook nachzeichnet (vgl. 580 ff.). In diesen Passagen profitiert der Autor von dem ihm gewährten Zugang und seiner Nähe zu den verantwortlichen Personen. An anderen Stellen hätte mehr Distanz gutgetan.
Wenn er beispielsweise über die Arbeitsbedingungen von Content Moderatoren schreibt, stützt er sich weitestgehend auf einen Besuch in Phoenix, Arizona. Dort hatte er die Möglichkeit (mit Facebooks Erlaubnis) mit Content Moderatoren, die für Facebook arbeiten, zu sprechen. Fazit: alles halb so wild. Andere Autoren waren da nach ihren Recherchen zu ganz anderen Ergebnissen gekommen (Riesewieck 2017; Roberts 2019).
Trotz kleinerer Schwächen: Facebook. Weltmacht am Abgrund ist eine spannende Nacherzählung der Geschichte eines Unternehmens, das unsere öffentliche Kommunikation wie kein zweites durcheinandergewirbelt hat.
Literatur:
- Kirkpatrick, D. (2011). Der Facebook-Effekt. Hinter den Kulissen des Internet-Giganten. München: Hanser.
- Riesewieck, M. (2017). Digitale Drecksarbeit. Wie uns Facebook & Co. von dem Bösen erlösen. München: dtv.
- Roberts, S. T. (2019). Behind the screen. Content moderation in the shadows of social media. New Haven: Yale University Press.
- Wergener, J. (2016). Wo Rechtsextreme ungestört zum Mord aufrufen. Online verfügbar: https://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/geheime-gruppen-auf-facebook-wo-rechtsextreme-ungestoert-zum-mord-aufrufen/14008436-all.html. 1
Links:
- Verlagsinformationen zum Buch
- Webpräsenz von Steven Levy
- Webpräsenz von Stephan Mündges an der Technischen Universität Dortmund
- 04.2020 ↩

