Rezensiert von Beatrice Dernbach
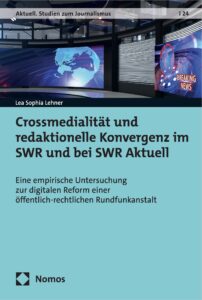

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht seit Jahrzehnten unter Beschuss. Waren und sind es in erster Linie die Zeitungsverleger, die nach wie vor die Finanzierung aus Gebührengeldern auf dem Kieker haben, kommen heute grundlegende politische, Struktur- und Vertrauensfragen hinzu. Zwar bedeuten die ökonomischen, politischen und sozialen Herausforderungen keine substanzielle Bedrohung des Systems, aber aufgrund des Legitimationsdrucks müssen sich die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu öffentlich-rechtlichen Medienhäusern entwickeln. Im Kern stehen dabei Social-Media-Strategien, um vor allem jüngere Menschen zu gewinnen und zu binden.
Das beschreibt kurz und viel zu knapp die Ausgangslage der umfangreichen Studie Lea Sophie Lehners, die in gekürzter Fassung seit einigen Monaten als Buch vorliegt. Im Zentrum ihrer Analyse steht die Crossmedialität gepaart mit dem Begriff der Konvergenz, verstanden als “‘Kreuzen’ der Medien” auf der Organisations-, Planungs-, Produktions- und schließlich Publikationsebene. Lehner untersucht organisatorische und strukturelle Veränderungen bei SWR Aktuell. Im Mittelpunkt steht das Veränderungsmanagement im gesamten Sender (vgl. 31). Sie unterlegt ihre Arbeit mit der Feldtheorie von Pierre Bourdieu und fokussiert dabei insbesondere auf den Hysteresis-Effekt. Er beschreibt das zeitliche Hinterherhinken von Akteuren angesichts struktureller Veränderungen. Gerade in einer hierarchischen Rundfunkanstalt erklärt dieses Konzept anschaulich, warum Wandel so träge verläuft. Honi soit qui mal y pense (beschämt sei, wer Schlechtes dabei denkt) – aber für die Beschreibung der Prozesse in einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt bietet diese Perspektive großes Interpretations- und Erklärungspotenzial. Empirisch mixt die Forscherin leitfadengestützte Experteninterviews und die teilnehmende Redaktionsbeobachtung.
Die Ausführungen in die Tiefe starten auf Seite 37 und replizieren den Stand der Erkenntnisse zu Journalismus, Mediennutzung und Medienvertrauen im Wandel, zu Konvergenz und neuen Formen der Medialität, beschreiben die öffentlich-rechtliche Medienlandschaft und fokussieren im fünften Kapitel auf den SWR. Der sechste Abschnitt beschäftigt sich mit dem Change Management im Allgemeinen und im siebten Kapitel wird das Werk Bourdieus im Hinblick auf seinen Nutzen für die Journalismusforschung ausgewertet. Nach einem Blick auf den Forschungsstand zu redaktioneller Konvergenz entwickelt Lehner auf festem theoretischen Fundament ihre drei Hauptfragen (vgl. 214–222) und erläutert im darauffolgenden neunten Kapitel ihre Methodik (22 Leitfadeninterviews und Redaktionsbeobachtungen in 15 Studios beziehungsweise Redaktionen). Der dramaturgische Höhepunkt beginnt im zehnten Abschnitt (vgl. 271–462) mit der Darstellung der Ergebnisse, erwartbar strukturiert entlang der Forschungsfragen.
Diese Rezension kann der Akribie, der Sorgfalt und der Qualität von Lehners umfangreicher Analyse nicht gerecht werden. Allein aufgrund der komplexen Struktur einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, des theoretisch komplexen Fundaments und des herausfordernden Methodenmixes muss die inhaltliche Beschreibung an dieser Stelle viel zu kurz bleiben. Deshalb springen wir in die Schlussbetrachtung (vgl. 463–529), um wenigstens einen kurzen Blick auf die Frage nach den Herausforderungen und Erfolgen des crossmedialen Wandels zu werfen.
Der SWR hat seine Organisations- und Finanzstruktur umgebaut, die strategische Neuausrichtung hat zu Veränderungen der Arbeitsprozesse und -weisen geführt. All dies wirkt sich auch auf die Tätigkeiten der Journalistinnen und Journalisten aus: Sie müssen Kanal- und Themen-Generalisten sein und sich auf einen anderen Publikationsrhythmus einstellen. Während Führungskräfte offenbar ausreichend in die Veränderungsprozesse einbezogen sind, gilt dies nicht gleichermaßen für die Redaktionsmitglieder. Ein elaboriertes Fortbildungsprogramm scheint die Notwendigkeit und die Akzeptanz des Wandels erfolgreich zu vermitteln. Als größte Bremse erweist sich neben dem Personalmangel – der wiederum Zeitmangel für die journalistische Arbeit nach sich zieht – das interne Kommunikationsdefizit, das bis hin zu Machtkämpfen führt. Alles in allem habe sich die Crossmedialität positiv auf die Qualität der Berichterstattung ausgewirkt (vgl. 487).
Da die Forschungsdaten bereits im November 2019 erhoben wurden, könnte der SWR in den vergangenen Jahren weitere Fortschritte bei der digitalen Transformation gemacht haben. Aktuelle Daten belegen eine leicht gestiegene Nutzung der Angebote und ein hohes Vertrauen. Die Stärken des SWR – wie auch die der anderen großen Anstalten – liegen in der regionalen Kompetenz. Aber dort stehen wieder die Verleger auf dem Plan und wittern Konkurrenz anstatt über Kooperationen nachzudenken.
Und wie steht’s eigentlich mit der Interpretation der Ergebnisse auf Basis Bourdieus? Wenig überraschend hat Lea Sophie Lehner aus den Interviews herausgehört, dass ältere Redaktionsmitglieder Probleme mit der Umstellung haben. Im Gegensatz dazu werden die Jungen bereits in der Ausbildung crossmedial sozialisiert und gewöhnen sich diesen system- und berufsspezifischen Habitus dementsprechend gar nicht erst an.
Links:
Über das BuchLea Sophia Lehner: Crossmedialität und redaktionelle Konvergenz im SWR und bei SWR Aktuell. Eine empirische Untersuchung zur digitalen Reform einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt. Baden-Baden [Nomos] 2025, 569 Seiten, 139,- EuroEmpfohlene ZitierweiseLea Sophia Lehner: Crossmedialität und redaktionelle Konvergenz im SWR und bei SWR Aktuell. von Dernbach, Beatrice in rezensionen:kommunikation:medien, 5. September 2025, abrufbar unter https://www.rkm-journal.de/archives/25643
