Rezensiert von Hans-Dieter Kübler
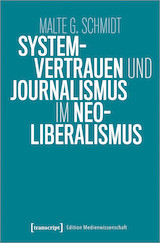

Misstrauen, ja Feindseligkeit und Aggressivität gegenüber staatlichen Institutionen, Skepsis, wenn nicht gar Ignoranz und Verachtung gegenüber den etablierten Medien und blindes Vertrauen in ideologische, verfälschende Plattformen haben sich bei bestimmten Bevölkerungsgruppen in den westlichen Demokratien tief eingegraben und verfestigen sich, auch wenn sie sich womöglich nicht weiter verbreiten. Da greift man gespannt zu einer überarbeiteten Dissertation aus Münster, die im Titel mit markanten, vielversprechenden Kategorien auffällt und wenigstens in der Einleitung auf deren Aktualität und Omnipräsenz hinweist: “Vertrauenskrisen haben Konjunktur” (11), und zwar in allen Bereichen, in persönlichen, wirtschaftlichen, politischen, bei Klima und Gesundheit etc.
Doch statt dafür theoretische Erklärungsansätze aus verschiedenen Disziplinen und empirische Befunde zu liefern, vertieft sich der Autor in systemtheoretische Grundlagenarbeit auf hoch abstraktem Niveau, weitab von empirischer Evidenz. Die “vielbeschworene Vertrauenskrise öffentlicher Institutionen” habe “dringenden Bedarf zur Rekonzeptualisierung von Systemvertrauen als vermittelndem Mechanismus zwischen Individuum und Gesellschaft”, erklärt er einleitend (13). Entlang der ersten “Leitfrage” nach dem Einfluss von Systemvertrauen auf Prozesse der Sozialreproduktion entfaltet er den ersten umfangreicheren Teil dementsprechend als ausführliche und penible “Literatursynopse holistischer Vertrauenstheorien”, die auch sprachlich kongenial mit den abstrakten Vorbildern mithält und den Lesenden anstrengende Rekonstruktionsarbeit abverlangt.
Den Anfang macht selbstredend N. Luhmann, und zwar der frühere mit seiner funktional-strukturellen Vertrauenstheorie, gefolgt vom späteren mit der autopoetischen Systemtheorie, in der die ursprüngliche Verschränkung von Gesellschaftskonstitution und individuellem Vertrauen weitgehend eskamotiert ist und Vertrauen nur noch am Rande, etwa als “wechselseitige Durchdringung von psychischem und sozialem System, als Mechanismus” (36), auftaucht. Deshalb bemüht der Autor als nächstes A. Giddens “Strukturationstheorie”, in der das “gesellschaftliche Gestaltungsvermögen von Akteuren eine basale Prämisse” (37) sei. Doch auch Giddens gelingt es nach Schmidts Einschätzung nicht, das Konstrukt der “teilautonomen Akteure” mit seiner Grundlagentheorie und dem Vertrauenskonzept plausibel zu verknüpfen, weshalb er ihm “wenig Kohärenz” attestiert (67). Weiter werden die Vertrauensansätze von M. Kohring im Hinblick auf den Journalismus, von J. Javala, Z. Pavlova und M. Haller begutachtet, die Luhmanns Konzepte kritisieren oder konform weiterentwickeln, um ihnen dann in einem Zwischenfazit zu bescheinigen, dass sie zwar “unverzichtbare Bausteine”, aber nicht das “notwendige Gerüst” für eine Theorie des Systemvertrauens liefern.
Vielversprechender seien daher “Ansätze der Neueren Systemtheorie”, “da sie allesamt die Rolle der Akteure bei der System(re)produktion hervorheben” (120). In U. Schimanks akteurzentrierter “Differenzierungstheorie” findet Schmidt den willkommenen “Grundstein” (121) – und man fragt sich, warum er nicht gleich zu ihm gegriffen hat, aber solche Literaturhuberei ist dem Format der Dissertation geschuldet. Gleichwohl identifiziert er auch bei Schimanks Konzept das Defizit, dass die “hervorgehobene Strategiefähigkeit der Akteure” nicht ausreichend als “Randbedingung im Vermittlungsprozess” berücksichtigt worden sei (147), weshalb er nun ein eigenes Konzept des Systemvertrauens vorlegt, das auch Antwort auf die erste Leitfrage gibt, “inwiefern Systemvertrauen einen Einfluss auf die Strukturdynamiken der differenzierten Gesellschaft hat” (149). Darin wird Systemvertrauen – auch nicht ganz einfach – als der “soziale Mechanismus” definiert, der die “reflexiven Interessen nach Erwartungssicherheit und Autonomie in der Teilsystemorientierung bis auf Widerruf dialektisch aufhebt” (161). Allerdings kann auch mit diesem Ansatz nicht entschieden werden, “ob Systemvertrauen strukturerhaltend oder -verändernd wirkt” (169) – womit alle praktischen Fragen von der abstrakten Theorie so ziemlich ungeklärt bleiben.
Im zweiten Teil, leicht obskur überschrieben mit “Über das Verschwinden der Unbestimmtheitslücke”, wird die Argumentation konkreter, mit empirischen Studien angereichert und mit demografischen, quantitativen Daten, unter anderem mit denen der so genannten IfK-Studie des Münsteraner Instituts für Kommunikationswissenschaft von 2018, und Grafiken veranschaulicht. Zunächst wird ein Konzept des Journalismussystems entfaltet, und zwar mit den Prämissen, dass es eine “herausragende Bedeutung für die Sozial- und Systemintegration in der Gesellschaft” habe (175); andere Funktionen, wie etwa die klassisch zugeschriebenen der Kritik und Kontrolle, bleiben ausgeblendet. Allerdings scheint solche Integration nicht bei allen Gesellschaftsmitgliedern zu gelingen (was die Systemtheorie bekanntlich partout nicht interessiert, da sie ja kein Konzept vom ganzen Menschen hat und ohnehin davon ausgeht, dass “Individuen in der funktional differenzierten Gesellschaft vollständig desintegriert” (203) sind). Insofern sind allenfalls die so genannten inkludierten “Bessergestellten” (204) einbezogen, während die sogenannten “Schlechtergestellten” allenfalls “mittelbar sozialintegrativ” tangiert werden.
Untermauert werden diese Spaltung und dichotomischen Funktionen durch das folgende Konzept des “Neoliberalismus”, das die westlichen Industriestaaten seit den 1970er Jahre heimsuchte, hier vor allem durch dominante und expansive Subjektivierungsweisen und Selbststeuerungsmaximen des Ich-Unternehmers charakterisiert wird und zu einem fundamentalen Ökonomisierungs- und Kommodifizierungsschub nicht zuletzt bei den Medien führte. Das Systemvertrauen internalisieren die Subjekte danach weitgehend als persönlichen Sachzwang der Systemerhaltung.
Doch der rigide Neoliberalismus ist selbst bei seinen erklärten Anhängern durch die zahlreichen Krisen des 21. Jahrhunderts weitgehend zurückgedrängt worden und wird wenigstens durch einen zaghaften Gestaltungswillen des Staates flankiert. Solch jüngere Entwicklungen kann Schmidt nicht mehr begutachten. Immerhin dürften die neoliberalen Spuren bei Journalismus und Medien noch prägend sein: Sie haben sich zu “reinen Dienstleistungsbetrieben” gewandelt, “die als Zielgruppe ihrer journalistischen Produkte nicht mehr (auch) Bürger*innen fokussieren, sondern nur noch Medienkonsument*innen” (256).
Zunehmend vorherrschend werde daher das “Politainment” (259) und der “Ratgeberjournalismus” (257). Gesamtgesellschaftlich verstärken sich autoritäre, aggressive und anomische Einstellungen, die nicht mehr gänzlich von der “sogenannten Modernisierungsverliererthese” (261) erklärt werden können. Das über weite Strecken verhandelte Systemvertrauen weicht dem “Zustand der Entfremdung” oder einer “Beziehung der Beziehungslosigkeit” (270), jedenfalls einer anhaltenden “Vertrauenskrise moderner Institutionen”, die “in einem sehr engen Zusammenhang mit der Krise des gesellschaftlichen Vertrauensintermediärs Journalismus” (278) steht. Aber genau hier fangen die analytische Arbeit und die theoretische Einordnung aktuell an.
Links:
Über das BuchMalte G. Schmidt: Systemvertrauen und Journalismus im Neoliberalismus. Bielefeld [transcript] 2021, 322 Seiten, 39,- EuroEmpfohlene ZitierweiseMalte G. Schmidt: Systemvertrauen und Journalismus im Neoliberalismus. von Kübler, Hans-Dieter in rezensionen:kommunikation:medien, 4. Februar 2022, abrufbar unter https://www.rkm-journal.de/archives/23134
