Rezensiert von Nicolas Romanacci
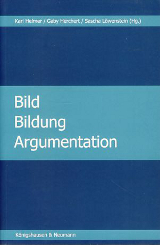

Die Beiträge von Anton Hügli und von Sascha Löwenstein, zwei aus Sicht des Rezensenten herausragende Artikel, sollen zu Beginn detaillierter besprochen werden. Einführend lässt sich zur Publikation insgesamt anmerken, dass hier im Rahmen der – oft problematischen – Heterogenität von Tagungsbänden die damit zusammenhängende Möglichkeit einer anregenden Zusammenstellung von Beiträgen gegeben ist. Diese liegen thematisch teils sehr weit entfernt, können jedoch hinsichtlich der kritischen Schlussfolgerungen gerade aufgrund ihrer Heterogenität oftmals gewinnbringend in Beziehung gesetzt werden. In vielen Fällen mündet die Darstellung sehr spezieller Problemfelder – wie etwa ‘Zusammenhänge von Metapher und Argumentation’ oder ‘Darstellungstechniken der Hirnforschung’ – in eine fundierte Kritik an Missständen des Bildungssystems.
Der Beitrag “Bilder oder Argumente – Bilder statt Argumente” von Anton Hügli stellt – wie bereits erwähnt – einen der herausragenden Texte des Bandes dar, hinsichtlich Relevanz (etwa für Fragestellungen im Grenzbereich von Medientheorie und Bildwissenschaft in analytischer Tradition), argumentativer Klarheit und fundiert kritischen Schlussfolgerungen. Der Text ist in sechs Abschnitte gegliedert.
1. Die Ausgangsfrage: In eleganter Weise Bezug nehmend auf Wittgenstein und Austin, fragt Hügli, ob “Argumentieren und mit Bildern operieren zwei verschiedene Sprachspiele sind”. Damit bereitet er seine Hauptthese vor, die besagt, dass “man im Zuge der Argumentation sich von Argumenten verabschieden und zu Bildern greifen muss” (16). Der folgende Abschnitt legt dar, wie man eine mögliche Antwort auf die Frage “Was ist ein Argument” – mit Verweis etwa auf die Ausführungen bei Habermas – bei einer Reflexion der Implikationen des Begriffes “Geltungsanspruch” ansetzen lassen könnte: Ein Sprecher muss seine mit jeder Äußerung erhobenen Geltungsansprüche begründen, ein Hörer wiederum hat immer die Freiheit, diese anzunehmen oder zurückzuweisen. Die performative Praxis des “sich/über etwas/mit einem anderen Verständigens” (Habermas 2009: 71) unterlaufe somit radikal eine einseitige, lediglich formal-logische Auffassung davon, was als Inbegriff des Argumentierens anzusehen sei.
2. Was ist ein Argument? Am Beispiel des Schwangerschafts-abbruchs zeigt Hügli auf, wie wir an einem bestimmten Punkt unsere Geltungsansprüche zurückführen müssen auf eine Reflexion darüber, welche Begriffe wir grundlegend gelten lassen wollen, um einer Sache sprachlich gerecht werden zu können. An diesem Punkt sieht er die entscheidende Grenze erreicht, bis zu welcher ein Grundkonsens gefunden werden kann darüber, welche Sprache überhaupt dem Gegenstand angemessen sei. Denn jeder Begründungsversuch via Argument müsste ja wieder begründet werden. “Mit diesem Hinweis auf ein mögliches Ende jeder Argumentation” (19) leitet Hügli über zur Frage “3. Was sind Metaphern?”. Hier gibt er eine knappe, sehr gelungene Darstellung der Funktionsweise von Metaphern in Bezug auf Max Blacks Interaktionstheorie. Kern der These ist, dass durch das metaphorische Reden ein Übertragungseffekt in Gang gesetzt wird.
4. Wie hängen Argumente und Metaphern zusammen? In diesem Abschnitt kehrt Hügli zum “Argumentationsnotstand” zurück, um den Zusammenhang von Metapher und Argument darzustellen. Denn sobald zur Diskussion steht, welche Sprache einem Gegenstand angemessen ist, komme die “motivationale Kraft der Metapher zum Ausdruck”. Sie macht “evident”, sie zeigt auf, “als was der Gegenstand nun gesehen werden soll” (25).
Diese erkenntnisleitende Funktion der Metapher betont Hügli noch einmal im anschließenden Kapitel “5. Bilder und Argumente in der Wissenschaft”, speziell in Kontrast zur Metaphernkritik der Logischen Positivisten. “Die Rolle von Argumenten und Metaphern in der Bildung” differenziert Hügli folgendermaßen: Einmal als ein Mittel der Didaktik, um dem “außerhalb der Wissenschaft” Stehenden den Zugang zu erleichtern, indem man ihn, über die Metapher, bei den “kognitiven Strukturen der Lebenswelt” (30) abholt. Auf der anderen Seite kann die Metapher im Rahmen wissenschaftlicher Forschung erkenntnisleitend wirken oder interdisziplinären Dialog zu ermöglichen. “In glücklichen Fällen kann eine ursprünglich theoriekonstitutive Metapher zugleich auch wieder – als Leiter von Wissenschaft zurück in die Alltagswelt – eine didaktische Funktion bekommen” (31).
In jedem Fall zeigen sich hier die kreativen Potenziale der Metapher, ihre erkenntnisleitende Funktion und damit ihr handlungsleitender Charakter. Hügli betont jedoch abermals die notwendige Skepsis gegenüber der Beeinflussung durch metaphorische Mittel: “Die Quintessenz, die wir aus all dem ziehen können, lautet darum kurz: Es ist zwar wahr: ohne Metaphern kämen wir nie voran mit unseren Argumenten, aber ebenso gilt: ohne Argumente kämen wir nie heraus aus unseren Metaphern.” (34)
Sascha Löwenstein bietet mit seinen Überlegungen zu “Menschen-Bilder(n) – Bildgebende Verfahren in der Hirnforschung und ihre Bedeutung für die Erziehungswissenschaften” einen ebenso informativen wie kritischen Beitrag. Löwenstein konstatiert, dass es zwar scheine, als ob “in den letzten Jahren für die Erziehungswissenschaften […] mit der Hirnforschung […] eine neue Leitdisziplin gefunden” (157) worden sei, es aber dabei erstaune, “dass die meisten Verfasser einschlägiger Studien etwa zum Lernen und Lehren, ihre Leser über die Hirnbilder, denen sie ihre Erkenntnisse abringen, im Unklaren lassen – auf eine Reflexion ihrer methodischen Bedingungen verzichten; bestenfalls werden ein Bezugsrahmen oder (vermeintliche) verbürgte Quellen angeführt” (159).
Löwenstein belässt es nicht bei dieser kritischen Anmerkung, sondern setzt einer leichtfertigen, im Wortsinn oberflächlichen “Hirnforschungseuphorie” (129) und einer – wegen ihrer meist wenig fundierten Argumente fragwürdigen – “Technologiesehnsucht von Pädagogen” (a. a. O.) eine differenzierte und pointierte Darlegung bildgebender Verfahren entgegen. Beschrieben und verglichen werden Computertomographie (CT), Magnetresonanztomographie (MRT) / funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT), Positronen-Emissions-Tomographie (PET). Er legt dar, in welcher Weise hier “Referenz-Objekte nicht einfach abgebildet” werden, sondern auf Grundlage von Messdaten und Algorithmen eine “‘zweite’ Realität entworfen” wird. “Für solche Bilder gilt mehr als für andere Bilder, dass ihnen […] ein ‘poetisches Moment’ eingeschrieben ist, das argumentativen Charakter” hat. (170) Eine Interpretation solcher digital erzeugten, hochartifiziellen Bilder beginnt “nicht erst mit der Bildbetrachtung, sondern bereits mit der Bildgenerierung” (173).
Löwenstein betont, dass die Hirnforschung als medizinische Grundlagenforschung nicht in Frage gestellt werden soll, gleichzeitig aber einer “unkritischen Hirnforschungseuphorie”, speziell in der Pädagogik, nicht gefolgt werden dürfe. Gerade hinsichtlich der Tendenz zur unbegründeten Vergabe von “pauschalen Rezepten und Verordnungen für die Therapie von Lern- oder kognitiven Leistungsstörungen” (176) müsse Vorsicht geboten sein. Auf der anderen Seite blieben die – nur vermeintlich neuartigen – Einsichten der Hirnforschung ebenso kritisch zu hinterfragen hinsichtlich ihres Erkenntniswertes.
Denn bei einem klaren Blick auf die positiven Erkenntnisse der handlungsorientierten Didaktik kann man auf Überzeugungen verweisen, “deren sich etwa Die Sendung mit der Maus seit mehr als 30 Jahren” bediene. “Vielleicht, so ließe sich schließen, täte einer kritischen Pädagogik, insbesondere aber einer innovativen und urteilssicheren Didaktik, die sich in einer von Erziehungs- und Wertepluralität, von empfindlichen Kostendämpfungen und beständigem Evaluationsdruck geprägten Lernumgebung zu behaupten sucht, etwas weniger ‘Technologiesehnsucht’ und etwas mehr Methodensicherheit gut.” (178)
Die Metapher thematisiert auch Alfred Schirlbauer in seinem Beitrag “Höhlen, Kräfte, Maulwurfsbauten und die Windung einer Schlange – ein Plädoyer für die Metapher”. Schirlbauer bezieht die Metapher in betont (sprach-) kritischer Haltung auf die problematische Inhaltsleere sogenannter “Plastikwörter” (73) im Sprachgebrauch “des dominant gewordenen Teils des pädagogischen Diskurses” (a. a. O.). Die polemische Ausrichtung des Beitrages erschließt sich dabei bereits durch die Übernahme des Begriffes “Plastikwort” von Uwe Pörksen, der diesen Begriff der “Sprache einer internationalen Diktatur” (a. a. O.) zuordnet. Diese Tendenz wird außerdem verdeutlicht durch ein Zitat von H.-J. Heydorn, welches die Behandlung der “Perspektivenlosigkeit der jüngeren pädagogischen Gegenwartssprache” (68) ankündigt. Schirlbauer verweist darauf, dass Heydorn “schon 1970 von der ‘zukunftslosen Sprache des Neopositivismus’ [spricht], welche von der Bildungstheorie Besitz ergreife”. (a. a. O.) “Sie deckt nicht auf, sondern verbirgt. Sie legt die reaktionäre Absicht nicht mehr offen, sondern sie hüllt sie ein. […] Das progressive Vokabular ist das Vokabular des kommenden Industriefaschismus […]” (Heydorn 2004: 261).
Ähnlich kritisch, aber weniger polemisch behandelt Egbert Witte in “Selbstbild und Bildung. Ein Versuch” u. a. den historischen Gebrauch des Begriffes “Bildung” im Gegensatz zum aktuellen Bildungsbegriff in unserem Bildungssystem. Ein Bildungssystem, welches “bei schlechter Umsetzung die Studierenden zwar dazu bringt, kräftig Leistungspunkte zu sammeln, denen aber vor lauter ‘work load’ Hören, Sehen, und Denken vergeht” (96).
Weiter entfernt von der Argumentationsforschung im engen Sinn und der Bildungsproblematik, aber immer noch im Rahmen von sprachlichen Bildern, ist der Text von Guillaume van Gemert einzuordnen: “Der Narr als Leitfigur rhetorischer Daseinsbewältigung. Bild und Weltordnung in der Frühen Neuzeit am Beispiel der deutschen Narrentradition”. Van Gemeert arbeitet über längere Passagen mit Quelltexten. Dies unterstützt die differenzierte Darstellung der Thematik.
Der Text von Gaby Herchert handelt “Von Weltbildern und Weltkarten”. Anhand mittelalterlicher und neuzeitlicher Weltkarten “sollte deutlich werden, dass Karten die Welt zeigen, wie Menschen sie sehen wollen. Karten bilden nicht ab, sondern entwerfen Bilder von Welt” (14). Der Zusammenhang zur Argumentationsforschung wird am Schluss erbracht, indem Herchert darauf hinweist, dass “theologische, ökonomische, historische und politische Begrifflichkeiten” erst aus der “Anschauung erschlossen werden” müssen; sie sind “in Bilder gesetzte Reden” und die “Logik ihrer Argumentation liegt nicht offen zu Tage” (14).
Der zweite Teil des Bandes beginnt mit drei Beiträgen zu religiösen Themen. Ein direkter oder indirekter Zusammenhang zur Argumentationsforschung oder der Bildungsthematik erschließt sich dabei nicht immer ohne weiteres oder nur in einem sehr weiten Sinn. Der Text von Alexandra Böck “Wie ‘ein gluehender backofen voller liebe’. Zum Menschen- und Gottesbild Martin Luthers” (101) mag ein wertvoller Beitrag zur theologischen Forschung sein. Auf die Bild-, Bildungs-, oder Argumentationsthematik bezogen wirkt dieser Text im Vergleich mit den anderen etwas isoliert. Die Schlussfolgerung etwa, dass, weil Luther Gott zum “bildmacher” erklärt und “der Mensch […] demnach […] Bild Gottes” (110) wäre, erscheint gerade im Kontext der differenzierten Erklärungen zu Luthers Menschenbild einseitig und eindimensional und eher an ein theologisch interessiertes Publikum gerichtet.
Der Autor verbleibt mit seiner Untersuchung nicht (nur) im Rahmen der theologischen oder der Mittelalterforschung, sondern argumentiert historisch-systematisch, indem er am Beispiel der Palästinabilder aufzeigt, dass “unsere Weltbilder zu einem Großteil aus unvollständigen vereinfachten Rekonstruktionen der Außenwelt bestehen” (111).
Henninger zitiert aus dem Essay über die ‘öffentliche Meinung’ (1922) des Publizisten Walter Lippmann: “Die Fakten, die wie erkennen, hängen von unserem Standort und unseren Sehgewohnheiten ab. […] In den meisten Fällen sehen wir nicht erst und definieren dann, sondern wir definieren zuerst und dann sehen wir. […] Aus dem großartig vielfältigen, geschäftigen Durcheinander der äußeren Welt greifen wir das heraus, was unsere Kultur für uns vordefiniert hat, und wir tendieren dazu, besonders das wahrzunehmen, was wir in Form von Stereotypen von unserer Kultur übernommen haben” (Lippmann 2007: 31). Die Untersuchung Henningers ist ein wertvoller Beleg für Lippmanns Aussagen. Gerade vor dem Hintergrund der Globalisierung ist es wichtig, (bild-) kritisch und möglichst differenziert darüber zu reflektieren und aufzuklären, wie sehr unsere “Bilder von Fremdheit” (114) vom jeweiligen kulturellen Hintergrund generiert werden.
“Reliquiengärten” untersucht Karl Helmer sowohl im religiösen als auch im kunsthistorischen Kontext. Im religiösen Kontext sieht Helmer den Bedeutungsverlust von Reliquien begründet durch den “Einfluss aufklärerischer Weltanschauung. Die ehedem sakrale Verehrung ist säkularer, naturwissenschaftlich orientierter Nüchternheit gewichen.” (132)
Aus kunsthistorischer Sicht wiederum kam den Reliquiengärten lange “nur geringe oder keine Bedeutung zu”, sie “wurden [erst] ab den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts mehr und mehr als besonders aufschlussreiche Zeugnisse des Glaubens und der Kultur vergangener Jahrhunderte erkannt.” (a. a. O.) Aus wissenschaftstheoretischer Perspektive wird hier Aufschluss darüber gegeben, wie eine Grundhaltung die Erfassung eines Forschungsgegenstandes nicht nur begrifflich vorzeichnet, sondern wie der Gegenstand überhaupt ins Blickfeld gerät. Aus bildwissenschaftlicher Sicht kann die Rehabilitierung der Reliquiengärten im kunsthistorischen Kontext verstanden werden als eine (enge) Auffassung bildwissenschaftlicher Forschung, als Erweiterung kunstwissenschaftlicher Forschungsbereiche über das künstlerisch wertvolle Bild hinaus zu generell bildhaften Kulturgegenständen.
Aufschlussreich ist neben derartigen grundsätzlichen Einsichten die Gegenüberstellung der Geringschätzung religiöser Reliquien durch ihre Säkularisierung mit dem Phänomen der zunehmenden Wertschätzung säkularer Reliquien. Letztere gewinnen dabei “mehr und mehr sakralen Charakter” (133). “Die Veränderung zeigt sich im Extrem an Arten der Selbstreliquisierung.” Hier wird ein überraschender Zusammenhang ersichtlich zwischen den Reliquiengärten und aktuellen Formen der Tiefkühlung von Leichnamen in der Hoffnung einer möglichen ‘Auferstehung’. Und so schließt der Text mit der Formulierung, dass hier das “Ich […] sich selbst dazu bestimmt (hat), bestaunte Reliquie zu werden.” (133)
Matthias Kemper setzt sich in seinem Beitrag “‘Ante oculos ponere’. Zur ikonischen und symbolischen Präsenz zeigender Rede” nach einer kurzen Reflexion des Verhältnisses von Bild und Text mit den Begriffen energeia und hypotyposis auseinander, um dann die Behandlung der Hypotypose bei Kant näher zu untersuchen. Eingebettet in eine einführende Thematisierung von Vorstellungen “zur Bildlichkeit der Sprache und zur Sprachlichkeit der Bilder” (138) sieht Kemper einen “Bezugspunkt von Rede und Bild […] in ihrer gemeinsamen Ausrichtung auf Persuasion” (a. a. O.).
Lebendigkeit und Anschaulichkeit als Wirkungen würden dabei “besonders einem Affektmittel zugeschrieben, dem bildlichen Vor-Augen-Stellen”, was in der Rhetorik “bereits in der griechischen Klassik an den Begriff der enargeia gebunden wurde” (a. a. O.). Eine Steigerung der Wirkung der enargeia “bietet die rhetorische Figur der Hypotypose. […] Der Rhetor betätigt sich hier gleichsam selbst als Maler, indem er Vielfältiges versammelt, das er zu einer Formation gruppiert und schließlich in eine lebendige Szenerie, in ein sprachliches Ereignisbild verwandelt.” (139) Die Wirkmacht von Bildern oder bildhaften Elementen der Rede “hat seit jeher eine philosophische Reserve und den theologischen Argwohn auf den Plan gerufen” (140): Ausprägungen von Bildkritik, auf die auch andere Autoren im Band hinweisen.
Kempers Untersuchung des Begriffes der Hypotypose bei Kant beginnt mit dem Verweis auf dessen “Invektiven gegen die Rhetorik”, speziell geäußert im §53 der Kritik der Urteilskraft. Gerade Kants Abneigung gegen die Hypotypose macht die Frage interessant , warum er dennoch “an der rhetorischen Figur der Hypotypose festhält” (a. a. O.). Kant traut der Hypotypose eine spezifische Leistung zu, “die er allerdings nicht der Rhetorik, sondern der Dichtkunst zuordnet […]”; die Hypotypose wird bei Kant “zum ästhetischen Ausdrucksmittel der Einbildungskraft, ein transzendentales Bild der Selbstverfasstheit des Geistes in seinen lebendigen Beziehungen der einzelnen Vermögen unter einander und im Hinblick auf das gemeinsame Zusammenspiel vorstellig zu machen.” (144)
Von Interesse für die erziehungswissenschaftliche Forschung wäre hier – wie Kemper am Ende des Beitrages noch kurz andeutet – grundlegend der Zeigeaspekt, die Deixis. Sie vereint die positive Wirkung von Anschaulichkeit einerseits mit einer problematischen Verführungskraft andererseits: “Man kommt aus den Bildern nicht mehr so schnell heraus, wie man in sie hineingelangt ist. Das Bild nimmt gefangen.” (145) Im Gegensatz zu diesen “öffentlichen” Formen der Bildlichkeit scheinen Kants Überlegungen dagegen “darauf angelegt zu sein” […] ein “Sich-Selbst-Vor-Augen-Stellen geleitet durch die Einbildungskraft” zu thematisieren, damit den Bildern “ihr fiktionales Pathos” zu entziehen und somit “Handlungsfähigkeit” zu eröffnen, “die sich unabhängig von äußeren Bestimmungseinflüssen zu konstituieren weiß” (145).
Lutz Koch diskutiert in seinem Beitrag “Argumentation und Evidenz in der Rhetorik” die Verbindungen von Argument und der “Evidenz der Augenscheinlichkeit” in der Rhetorik. Er stellt die Verführungskraft auf affektiver Ebene der erkenntnisleitenden und hermeneutischen Funktion gegenüber, welche als ein Moment der Argumentation begriffen werden kann, denn “das Bild der Sache gehört zum Verstehen des Argumentes dazu” (155).
Harm Paschens Beitrag “Comenius’ und Rembrandts Argumentationsformen zur Integration heterogener Wissensbestände” (179) leitet aus historischen Beispielen mögliche Perspektiven für aktuelle Aufgaben einer integralen Pädagogik ab. Dabei unterscheidet er exemplarisch die Herangehensweisen von Comenius und Rembrandt. Sie “argumentieren beide kritisch im Kontext der Entstehung der modernen Wissenschaft, der erstere offen und diskursiv für ein pädagogisches Programm der phantenosia, der zweite ikonisch mit einer etwas verborgenen, zur Reflexion aufrufenden Botschaft” (187). Insgesamt eine überzeugende Anregung angesichts heutiger Herausforderungen bei der Integration und Vermittlung heterogener Wissensdomänen.
Ausgangspunkt für Petra Reinhartzs Beitrag “Bilder-Räume in ihrer Bedeutung für Bildungsprozesse” ist “zwar die Diskussion um den ‘lingusitic turn’ und ‘iconic turn’ – das erkenntnisleitende Interesse entstand aber aus Erfahrungen und Beobachtungen im Rahmen der Lehrerbildung.” (211) Reinhartz verweist auf einen Zusammenhang zwischen unbefriedigenden Möglichkeiten zur Werkbetrachtung im Kunstunterricht aufgrund von “Wahrnehmungs- und Bildungsschablonen“ und daraus resultierenden Defiziten bei der Beobachtung des Verhaltens von Kindern im Unterricht. Den Kindern wird aufgrund einer zu selbstverständlichen Interpretation des Gesehenen vorschnell – “nach schon einer Unterrichtsstunde!” –ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ‘diagnostiziert’, “ohne dass der Akt der Bedeutungszuschreibungen auf Gesehenes mitreflektiert wird” (211). “Eine minutiös geplante Unterrichtsstunde […] lässt keinen Raum mehr zum Sehen” (a. a. O.). Petra Reinhartz kontrastiert eine derartige oberflächliche Betrachtungsweise im Bildungsbetrieb mit ihren eigenen, sehr sensiblen Beobachtungen der künstlerischen Praxis des Malers Heinz Mollet und ihren Reflexionen zu Wim Wenders Beschreibungen des Entstehungsprozesses seines Films Der Himmel über Berlin (206), um Perspektiven auf eine fundiertere Praxis des Sehens zu eröffnen.
Literatur:
Habermas, Jürgen (1981): Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt am Main
Habermas, Jürgen (2009): Zur Kritik der Bedeutungstheorie. In: Rationalitäts- und Sprachtheorie. Philosophische Texte, Bd. 2. Frankfurt am Main, 70-104
Heydorn, Heinz-Joachim (2004): Über den Widerspruch von Bildung und Herrschaft [1970]. Wetzlar
Lippmann, Walter (2007): Public Opinion. Miami
Links:
- Verlagsinformationen zum Buch
- Webpräsenz von Prof. Dr. Andreas Dörpinghaus am Institut für Pädagogik an der Universität Würzburg
- Homepage von Nicolas Romanacci
Über das BuchAndreas Dörpinghaus; Karl Helmer (Hrsg.): Bild – Bildung – Argumentation. Reihe: Beiträge zur Theorie der Argumentation in der Pädagogik, Band. 5. Würzburg [Königshausen & Neumann] 2012, 220 Seiten, 29,80 Euro.Empfohlene ZitierweiseAndreas Dörpinghaus, Karl Helmer (Hrsg.): Bild – Bildung – Argumentation. von Romanacci, Nicolas in rezensionen:kommunikation:medien, 20. August 2012, abrufbar unter https://www.rkm-journal.de/archives/9699

